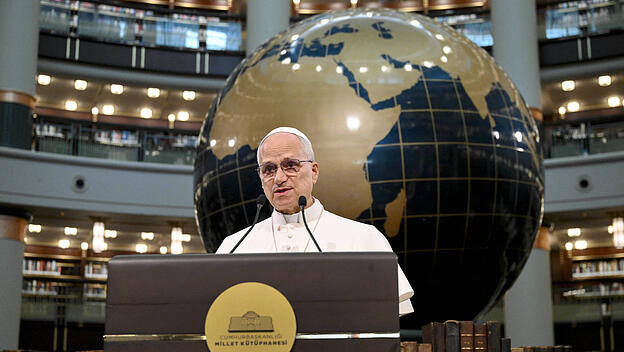Der heilige Johannes XXIII. wäre über das Kardinalskollegium, das in dieser Woche einen neuen Papst wählt, äußerst überrascht. Nie war der Austausch in regionalen Sprachgruppen wichtiger als bei diesem Konklave, denn es gibt keine gemeinsame Sprache mehr. Für einige dürfte die päpstliche Apostolische Konstitution Veterum Sapientia von 1962, die Latein als gemeinsame Theologensprache verankerte, schlicht Makulatur sein, weil sie auf die Sprache der Kirche gänzlich verzichten. Erstmals bei einem Konklave sind Purpurträger mit von der Partie, deren Wahlspruch in der Landessprache und nicht auf Latein im Wappen steht. Auch der Vatikan selbst schließt die Verständnislücken nicht. Über den Wahlspruch des Kardinals von Tonga („Ke loloto e tui“) etwa darf weiter gerätselt werden.
Eine praktische Umsetzung der päpstlichen Anordnung, Latein als Wissenschaftssprache zu fördern und die zentralen theologischen Fächer an Priesterseminaren und Hochschule in der Sprache der Kirche zu unterrichten, haben wohl nur die wenigsten Kardinäle in ihrer eigenen Priesterausbildung erlebt. Doch bis zum Ende des 20. Jahrhundert galt bei Kirchens das ungeschriebene Gesetz, dass Priester, die für Leitungsaufgaben bestimmt waren, einen Teil ihrer Ausbildung in Europa absolvierten. Insofern konnten sich katholische Würdenträger durchaus in gemeinsamen Bildungswelten begegnen, auch wenn ihre Heimatdiözesen weit auseinanderlagen. Ein Beispiel dafür ist Kardinal Robert Sarah, der in der westafrikanischen Provinz geboren wurde und seinen europäischen Mitbrüdern in puncto klassischer Bildung mühelos das Wasser reichen kann. Hier hat sich der Wind unter Papst Franziskus gedreht. Auch traditionsreiche Bischofsstühle sind inzwischen mit Hirten besetzt, hinter deren Kommunikationsfähigkeit auf dem Parkett der Weltkirche - bei aller zugestandenen menschlichen Integrität - ein Fragezeichen zu setzen ist.
Wie Kardinälen vertrauen, die ihren Standpunkt nicht bekanntgeben?
Spekulationen begleiten jedes Konklave, doch vor der Wahl des Nachfolgers von Papst Franziskus zeichnen sich die unterschiedlichen Sichtweisen innerhalb der Weltkirche deutlicher als sonst ab. Fast widerwillig berichten deutsche Zeitungen im Zusammenhang mit den Kandidaten für das Papstamt über den „Außenseiter“ Kardinal Gerhard Müller. Dass der vormalige Präfekt der Glaubenskongregation es trotz seiner dezidierten Positionierung gegen den Synodalen Weg überhaupt in die deutsche Mediendebatte über Papabili geschafft hat, liegt nicht zuletzt an katholischen Journalisten im angelsächsischen und spanischsprachigen Raum, die seinen Namen ins Spiel gebracht haben und fast täglich neue Interviews mit ihm veröffentlichen. In den beiden größten Sprachgruppen der katholischen Kirche genießt der deutsche Kardinal mehr Wohlwollen als in der Heimat.
Für das Ergebnis des Konklaves dürfte das zwar keine Rolle spielen, denn bekanntlich kommt als Kardinal aus dem Konklave, wer als Papst hineingegangen ist. Doch in den Kommentarspalten klingt das Vertrauen auf die klare Linie des Kardinals in doktrinellen Fragen durch. Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, lässt sich spielerisch beobachten: Auffallend oft muss der Kardinal-O-Mat in puncto theologische Überzeugung eines Kandidaten passen und ein Fragezeichen hinter die Haltung eines Kardinals zu den Kriterien Frauendiakonat, Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, Zölibat, alte Messe, Synodale Kirche, Klimawandel, Neubewertung der Papst-Enzyklika Humanae Vitae, Kommunion für geschiedene und wiederverheiratete Katholiken sowie dem deutschen Synodalen Weg setzen. Bei einigen Kandidaten entfällt der Hinweis auf die Wahlprüfsteinen ganz. Wer vertraut Papstwählern, deren theologische Überzeugungen der Öffentlichkeit weitgehend verborgen bleiben? Unter Letzteren befinden sich nicht nur weitgehend unbekannte Kardinäle von den Rändern der Erde, sondern auch der Primas von Kolumbien und der Patriarch von Bagdad. Von dieser Warte aus erschließt sich, warum nicht wenige Katholiken in anderen Ländern streitbare Konservative als Gewinn für die Kirche betrachten. An einem Mitraträger mit klarem katholischen Profil mag sich mancher reiben, aber die Traditionsverfechter im Senat des künftigen Papstes verkörpern dank ihrer theologischen Berechenbarkeit die Stabilisatoren des Kirchenschiffs.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.