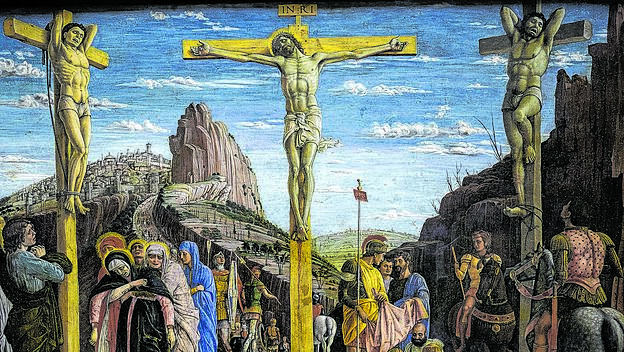Wie soll sich die Kirche angesichts von Säkularisierung und wachsender religiöser Indifferenz in Europa verhalten? Diese Frage stand im Zentrum des diesjährigen Kongresses des katholischen Osteuropa-Hilfswerks „Renovabis“.
Die rund 230 Teilnehmer kamen vom 10. bis zum 12. September im bayerischen Freising zusammen, um Vorträgen namhafter Referenten und prominent besetzten Podiumsdiskussionen beizuwohnen. Zudem bot sich allen die Gelegenheit, sich aktiv in Workshoprunden zu aktuellen Fragen – von Glaubens-Influencern bis Klimaschutz-Pastoral war an Themen alles geboten, was den Zeitgeist bewegt – einzubringen.
Getagt wurde im prachtvoll erneuerten Asam-Saal, der nach Cosmas Damian und Egid Quirin Asam benannt ist. Das bekannte Brüderpaar war für die Renovierung und damit einhergehende Rokokoisierung des Freisinger Doms um das Jahr 1724 verantwortlich. Überhaupt hat sich Freising anlässlich von 1300 Jahren Korbinian herausgeputzt. Der Heilige und erste Bischof von Freising hatte das Bistum zu einem Kraftzentrum des Glaubens geformt. Sowohl die äußeren Bedingungen als auch der Genius Loci hätten für das gewählte Thema also nicht besser sein können.
Sinkende Religiosität in Westeuropa - mit einer Ausnahme
Detlef Pollack, Professor für Religionssoziologie an der Universität Münster, legte mit einer ebenso nüchternen wie fundierten Analyse der religiösen Situation in Europa den Grundstein für die folgenden Diskussionen. Der routinierte Hochschullehrer ließ sich auch durch eine streikende Technik nicht aus der Ruhe bringen. Die entscheidenden Zahlen kannte er aus dem Kopf. Diese wiesen in allen westeuropäischen Ländern – lediglich Portugal bilde eine kuriose Ausnahme – eine sinkende Religiosität aus. In Westdeutschland sei das Vertrauen in die Kirchen auf einem Tiefpunkt angelangt und rangiere auf dem Niveau des Vertrauens in Banken, Wirtschaftsberater und die Hauptstrommedien.
Anders sei dagegen die Lage in Skandinavien. Dort verzeichne man einen Zuwachs des Vertrauens in die Kirche. Allerdings sei diese dort primär als Bildungs- und Dienstleistungsinstitution anerkannt. Damit drängte sich dem Zuhörer der Gedanke auf, dass sich die weltliche Anerkennung der Kirchen tatsächlich erkaufen lässt, allerdings um den Preis der überweltlichen Ausrichtung.
Wiederum ein anderes Bild zeige sich in Osteuropa, wo das religiöse Feld aber nicht einheitlich sei. Doch auch hier konstatierte Pollack besorgniserregende Trends. Im einstigen katholischen Musterland Polen etwa sei die Zahl der Gläubigen von 90 auf 70 Prozent zurückgegangen; zugleich habe sich auch beim Kirchenbesuch ein starker Rückgang vollzogen. Der Einbruch betreffe vor allem die jungen Generationen. Aus soziologischer Perspektive lasse sich eine Korrelation dieser Entwicklungen mit Wohlstandswachstum und zunehmendem Materialismus feststellen. Die These liegt nahe, dass die Möglichkeit kapitalistischer Zerstreuung die existenziellen Sinnfragen, deren Antworten über Jahrhunderte im christlichen Glauben und in der Lehre der Kirche gefunden wurden, zu verdrängen oder zumindest zu überdecken vermag.
Zudem diagnostizierte Pollack eine Tendenz zur Individualisierung des Glaubens, zu einem neuen religiösen Eklektizismus. Jedoch verwies der Forscher die verbreitete Auffassung, man könne gläubig sein, auch ohne einer organisierten Religion anzugehören, ins Reich der Illusionen. Die empirische Datenlage zeige vielmehr eine starke Korrelation zwischen dem Verlust der Kirchenbindung und dem Verlust des Glaubens. Eine bedenkenswerte soziologische Variante des Satzes „Extra ecclesiam nulla salus“: Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil.
Patriotismus und Religiosität gehen Hand in Hand
Der Vortrag Pollacks benannte aber auch einen verblüffenden Gegentrend zu diesen Verfallszahlen: Nationen, in denen die Orthodoxie gepflegt werde, befänden sich im religiösen Aufschwung. Die Erklärung des Professors verwies auf die Korrelation zwischen einem starken Nationalbewusstsein und religiöser Bindung: Wo es Teil des patriotischen Selbstverständnisses sei, zu einer bestimmten Kirche zu gehören, wachse auch die Bedeutung der jeweiligen Religion. Zu beobachten sei dies auch in der kriegsgebeutelten Ukraine. Dort sei seit der russischen Invasion die positive Bewertung des Nationalstolzes, zumindest soweit er sich in Umfragen messen lässt, von 40 auf 90 Prozent gestiegen.
Die durch die Lage geradezu selbstverständliche hochpatriotische Stimmung in der Ukraine schwappt nun schon seit längerem auch auf die Verbündeten im westlichen Ausland über. Ein Beispiel dafür lieferte Pfarrer Thomas Schwartz, der Hauptgeschäftsführer von „Renovabis“, als er den Anwesenden im Rahmen seiner Eröffnungsrede ein schallendes „Slava Ukraini“ entgegenrief. Dagegen erscheint vor diesem Hintergrund die von den deutschen Bischöfen zu vernehmende pauschale Verurteilung eines ausgeprägten Nationalbewusstseins als „Nationalismus“ geradezu als kontraproduktiv, wenn es um die Stärkung des Glaubens gehen soll.
Bojidar Andonov, emeritierter Professor für Religionspädagogik und Homiletik an der Orthodox-theologischen Fakultät der Universität Sofia, ergänzte Pollacks Ausführungen zum Zusammenhang von Nationalbewusstsein und Religion mit einem Beispiel aus der Geschichte Bulgariens: Während des 500 Jahre währenden osmanischen Jochs seien Tradition und Sprache vor auch allem dank der Orthodoxie bewahrt worden.
Nachdem die Faktenlage derart detailliert erörtert worden war, stand die Frage, wie mit der herrschenden Krise umzugehen sei, im Mittelpunkt. Von Einmütigkeit konnte hier jedoch keine Rede sein. Vielmehr zeigte sich einmal mehr, dass die Kirche am Scheideweg steht.
Auflösung oder Bewahrung des Überlieferten?
Jan Loffeld, Pastoraltheologe von der Tilburg Universität in Utrecht, vertrat die Ansicht, man könne nicht-religiösen Menschen heute nicht mehr mit der Botschaft entgegentreten, dass ihnen etwas fehle. Das Zweite Vatikanum hätte daher aus gutem Grund den suchenden an die Stelle des sündigen, erlösungsbedürftigen Menschen gesetzt. Daher gelte es, konsequent einen Paradigmenwechsel zu vollziehen von der „Bedürfnisprämisse“ hin zur „Diversitätsprämisse“: „Jeder Mensch kann Gott finden, braucht ihn subjektiv aber nicht unbedingt für sein Glück.“
Unerwähnt blieb jedoch, dass offenbar beides zusammengehört: das Suchen wie das Bedürfnis. Denn nur insofern im Menschen ein von nichts Weltlichem zu stillendes Bedürfnis existiert, wird er sich überhaupt auf die Suche nach etwas Transzendentem begeben. Entsprechend hat auch das Zweite Vatikanum selbstverständlich nicht die Lehre von der Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit des Menschen revidiert.
Ganz andere Töne waren dagegen vom tschechischen Kirchenhistoriker Tomáš Petráček zu vernehmen. Statt einer Abschwächung des Anspruchs plädierte er dafür, die eigene Diasporasituation – Tschechien sei eines der stärksten säkularisierten Länder der Welt – anzunehmen. Erst die Aufgabe des Kampfes um gesellschaftliche Relevanz, so die paradoxe These, könne auch wieder zur weltlichen Bedeutung der Kirche führen.
Die krassesten Bruchlinien aber taten sich am letzten Tag des Kongresses auf. Bei der abschließenden Podiumsdiskussion, an der unter anderen die Kirchenkritikerin Doris Reisinger sowie der Berliner Erzbischof Heiner Koch teilnahmen, wurde deutlich, dass es schwierig oder gar unmöglich sein dürfte, einen einmütigen Weg aus der Krise zu finden. Denn bei der Frage nach den „Zukunftsperspektiven für die Kirche und den christlichen Glauben in Europa“ stießen zwei grundverschiedene Ansichten aufeinander.
Während Reisinger die radikale Enthierarchisierung der Kirche und damit auch die Auflösung ihrer sakramentalen Struktur forderte, hielt insbesondere Gintaras Grušas, der Erzbischof von Vilnius, dagegen: Mit Blick auf die weltkirchlichen Tendenzen müsse sich die Kirche auf Jesus Christus, ihre Tradition und ihren gegenkulturellen Charakter zurückbesinnen. Auch Erzbischof Koch bekannte sich zur sakramentalen Ordnung der Kirche. Eine höflich formulierte, aber auf den Kern der Auseinandersetzung zielende Frage aus dem Publikum machte zum Abschluss deutlich, wie verhärtet die Fronten sind: Wie Reisinger mit der Tatsache umgehe, dass Gott in Jesus Christus eindeutig als Mann und nicht als Frau Fleisch geworden ist, woraus sich theologisch ableite, dass das Priesteramt Männern vorbehalten ist? Die Gefragte verweigerte die Antwort mit dem Hinweis: „Wenn Sie das denken, ist das Ihr Problem.“
So stand am Ende des Kongresses die Erkenntnis, dass die Kirche im Moment noch zu häufig mit sich selbst und internen Konflikten beschäftigt ist, um in ganzer Breite „glaubwürdig Zeugnis zu geben“, wie es der Titel des diesjährigen „Renovabis“-Kongresses eigentlich angekündigt hatte.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.