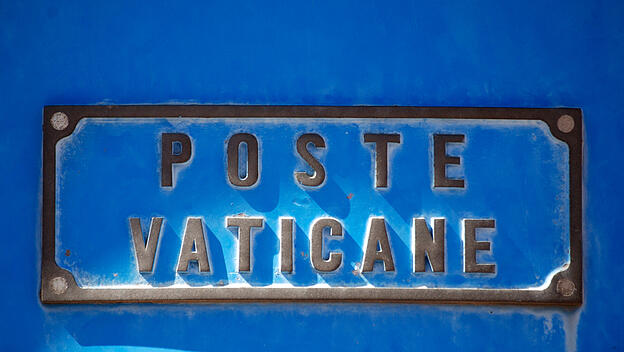„Wir müssen nicht die ganze Welt missionieren und für eine bestimmte Form kirchlichen Lebens gewinnen.“ Diese These trug der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck in seiner Neujahrspredigt vor. Alle Menschen seien frei und Gott werde schon Wege finden, um auch diejenigen auf einen guten Weg zu führen, die nicht an ihn glauben könnten oder wollten, so der Ruhrbischof weiter. Was zunächst vielleicht nach Gelassenheit und Gottvertrauen aussieht, erweist sich spätestens nach ein wenig Reflexion als hochproblematisch.
Das Vertrauen, dass Gott jedem Menschen ein hinreichendes Maß an Gnade schenkt, damit dieser sie aus freien Stücken ergreifen und somit zum ewigen Heil kommen kann, ist im katholischen Glauben an einen gleichermaßen gerechten wie barmherzigen Gott begründet. Daraus folgt aber keineswegs, dass wir uns als Christen bequem zurücklehnen sollten, wenn es um das Seelenheil unserer Mitmenschen geht, in der vermessenen Gewissheit „Der Herr wird’s schon richten“.
Christsein heißt, sich zum Werkzeug Gottes machen zu lassen
Denn der auferstandene Christus selbst hat uns schließlich den Auftrag erteilt, den Glauben in die ganze Welt zu tragen: „Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Mt 28,19–20). Christsein heißt auch, sich zum Werkzeug Gottes machen zu lassen, in diesem Fall zum Werkzeug der Mission.
Die Abkehr vom Missionsauftrag Christi begründete Overbeck in seiner Predigt auch damit, dass immer mehr Menschen in Deutschland „ganz selbstverständlich ohne Gott“ lebten. „Sie brauchen keine Religion, keinen Glauben und schon gar keine Kirche, sind glücklich und zufrieden und führen oft ein erfülltes Leben und sind dabei keineswegs egoistische Menschen“, so Overbeck weiter. Dass religionssoziologische Studien dies über die Zufriedenheit ungläubiger Menschen in westlichen Wohlstandgesellschaften herausgefunden haben wollen, mag sein. Die entscheidende Frage aber ist freilich, welches Verständnis von Glück und Zufriedenheit solchen Umfragen zugrunde liegt.
Christen müssen an ihr ewiges Heil denken
Die Möglichkeiten, die innere, in so vielen unbewusst schlummernde Sehnsucht nach dem Schöpfer zu übertünchen, sind heute schier unendlich. An jeder Ecke lauern neue virtuell vermittelte Dopaminkicks und Zerstreuungen, die die ins Transzendente verweisenden Sinnfragen zum Schweigen bringen. Aber wenn einer trotzdem einmal ernsthaft und gründlich fragt „Wozu das alles?“, so wird er nichts auf dieser Welt finden, das ihm eine befriedigende Antwort hierauf geben könnte.
Auch wenn es sich unsere Mitmenschen in der Gottlosigkeit eingerichtet haben, müssen wir als Christen in erster Linie nicht an ihr weltliches Wohl, sondern ihr ewiges Heil denken. Alles andere wäre egoistisch, ja lieblos, weil es im anderen nur ein gewöhnliches, aufs Diesseits beschränktes Wesen sehen würde. Wie aber C. S. Lewis einmal schrieb, gibt es „keine gewöhnlichen Menschen“. Vielmehr sind es „Unsterbliche, mit denen wir scherzen, mit denen wir arbeiten, die wir heiraten, die wir brüskieren und ausbeuten - unsterbliche Schrecken oder ewige Herrlichkeiten.“
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.