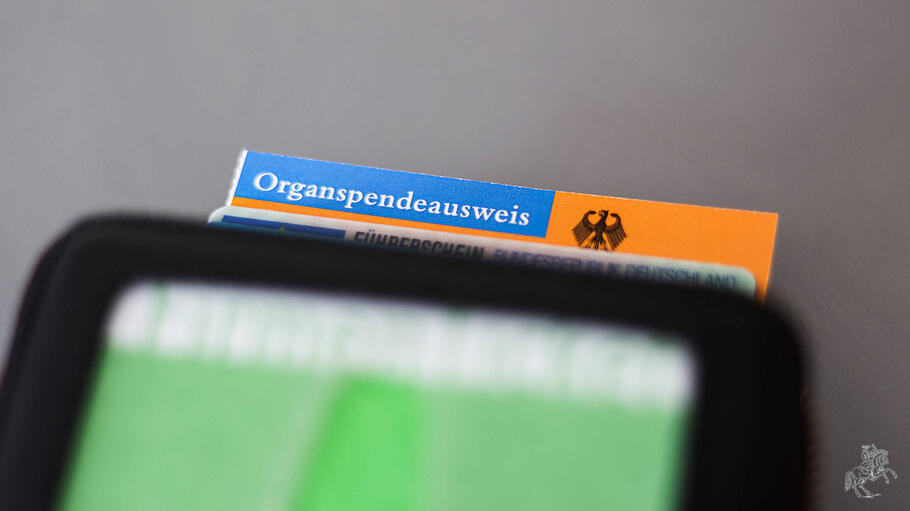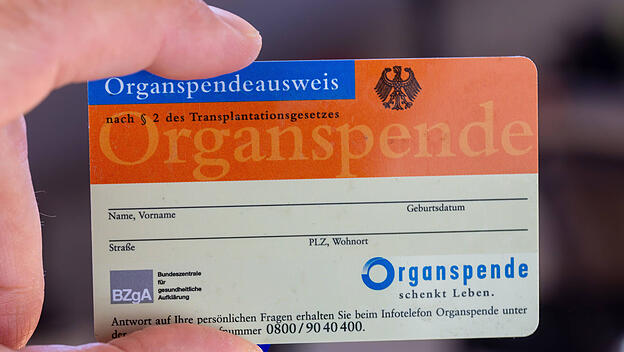Der erneute interfraktionelle Vorstoß zur Einführung einer Widerspruchsregelung bei der Organspende (Bundestagsdrucksache 20/13804) ist bei der Öffentlichen Anhörung im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages überwiegend auf Kritik der geladenen Sachverständigen gestoßen.
Die Göttinger Medizinethikerin Claudia Wiesemann sagte, die Widerspruchsregelung sei ein Eingriff in die Selbstbestimmung der Person über ihren eigenen Körper. Wichtigstes Rechtfertigungsargument sei eine erhoffte deutliche Zunahme der Organspendenzahlen. Diese Hoffnung könne jedoch empirisch nicht belegt werden. Es gebe vielmehr Anlass zur Sorge, dass die Zahl der Lebendorganspenden parallel zurückgehen werde. Das Hauptproblem sei die mangelhafte Meldebereitschaft der Krankenhäuser. Lösungsversuche müssten daher dort ansetzen.
Schweigen darf nicht als Zustimmung gewertet werden
Der evangelische Theologe und Ethiker Peter Dabrock von der Universität Erlangen-Nürnberg, der eigenen Angaben zufolge Besitzer eines Organspendeausweises ist, kritisierte den Mangel an Aufrichtigkeit in der Debatte. Der Begriff „Widerspruchlösung“ insinuiere, dass das Verfahren in der Lage sei, die Lücke zwischen benötigten und allokierbaren Organen geschlossen werden könne. Das sei aber bereits aufgrund der Zunahme chronischer Erkrankungen wie der Alterung der Gesellschaft nicht Fall.
Zur Ehrlichkeit gehöre das Eingeständnis, dass kein Verfahren eine Beendigung der Organknappheit herbeiführen könne. Der „Flaschenhals“ im Organgewinnungsprozess sei nicht die Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Vielmehr gelinge es nicht, die Zahl der organspendenbezogenen Kontakte signifikant zu steigern. Ferner unterminiere die Widerspruchsregelung den Charakter der Organspende als „freiwilliger Gabe“. Wer etwas wolle, müsse fragen. Schweigen sei keine Zustimmung.
Ähnlich äußerten sich die Kirchen. „Bei der Regelung der Organspende sollte – wie der Begriff schon ausdrückt – der Charakter einer freiwilligen Organspende im Sinne einer bewusst und höchstpersönlich getroffenen eigenen Entscheidung erhalten bleiben“, erklärten das Kommissariat der deutschen Bischöfe und die Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in einer gemeinsamen Stellungnahme.
Widerspruchregelung gefährdet Vertrauensverhältnis von Arzt und Patient
Der Gießener Staatsrechtler Steffen Augsbergs vertrat die Überzeugung, statt Probleme zu lösen kreiere die Widerspruchslösung neue. Der Chirurg Andreas Weber, ehemaliges Mitglied eines chirurgischen Einsatzteams zur Organexplantation der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO), kritisierte, dass die Interessen und Rechte des Organspenders in der öffentlichen Debatte unterrepräsentiert seien. Seiner Ansicht nach gefährdet die Widerspruchsregelung zudem das Vertrauensverhältnis von Arzt und Patient.
Kritik äußerte der Arzt auch an der Hirntoddiagnostik. Es gebe zahlreiche dokumentierte Fälle, dass zuvor als „hirntot“ diagnostizierte und zur Organentnahme freigegebene Patienten kurz vor der Explantation Zeichen von Leben gezeigt hätten, so dass die Explantation abgebrochen werden musste.
Der Palliativmediziner Winfried Hardinghaus, Geschäftsführender Vorstand des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes, bezweifelte, dass die Einführung einer Widerspruchslösung Angehörige entlasten könnte. Auch bei einer Widerspruchlösung könnten diese in einen Schockzustand, tiefe Trauer und schwerwiegende, familiäre Konflikte geraten. Vertrauen und damit eine höhere Bereitschaft, Organe zu spenden, könne nur durch die Behebung von organisationsethischen Defiziten entstehen. Auch die frühere Bundesgesundheitsministerin und Bundesvorsitzende der Lebenshilfe, Ulla Schmidt (SPD), sprach sich gegen die Einführung einer Widerspruchsregelung im Transplantationsgesetz aus.
Lindner: Derzeitige Regelung verstößt gegen Grundgesetz
Dagegen plädierten die Vertreter der Bundesärztekammer und der Deutschen Stiftung Organtransplantation für die Einführung einer Widerspruchsregelung. Der Transplantationsmediziner Bernhard Banas vom Universitätsklinikum Regensburg erklärte, die wiederholt vorgebrachte Idee, allein durch organisatorische Verbesserungen in Krankenhäusern die Organspendenrate ausreichend zu verbessern, müsse als gescheitert angesehen werden. Frühere Gesetzesänderungen hätten nicht die erwünschten Erfolge gebracht.
Auch der Augsburger Medizinrechtler Josef Franz Lindner sprach sich für die Einführung der Widerspruchsregelung aus. Nach Ansicht Lindners verpflichtet Art. 74 Abs. 1 Nr. 26 Grundgesetz den Bundesgesetzgeber für ein effektives Organtransplantationssystem zu sorgen. Dazu zähle auch die Pflicht, die gesetzlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass eine ausreichende Zahl an Spenderorganen generiert werde. Bei der konkreten Ausgestaltung des Organtransplantationsrechts habe der Gesetzgeber einen Gestaltungsspielraum, der seine Grenze am Untermaßverbot finde. Der Gesetzgeber verstoße gegen seine aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgende Schutzpflicht, wenn er keine oder nur solche Maßnahmen ergreife, die – im Hinblick auf den Gesamtbedarf an Spenderorganen – nur eine marginale Verbesserung darstellten.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.