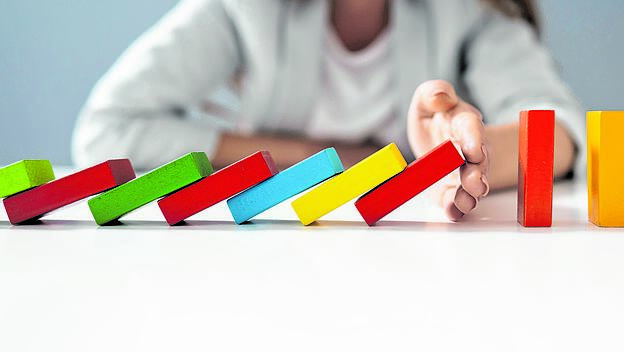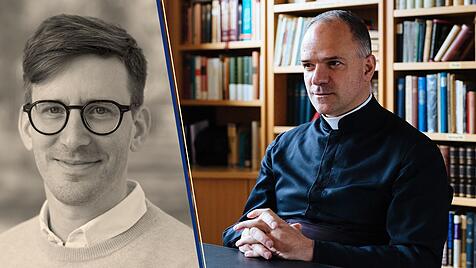Die französische Nationalversammlung hat das umstrittene Euthanasie-Gesetz in erster Lesung angenommen. 305 Abgeordnete stimmten am Dienstag in erster Lesung für den Entwurf, der erstmals ein Recht auf „Hilfe beim Sterben“ schaffen soll, 199 Parlamentarier stimmten dagegen. Neben einem weitgehend konsensfähigen Gesetzentwurf zur Stärkung der Palliativversorgung sorgte vor allem dieser zweite Text für kontroverse Debatten – quer durch alle politischen Lager.
2024 war das Gesetz im ersten Anlauf an der Auflösung der Nationalversammlung gescheitert. Eine Neuregelung der Gesetzgebung zum Lebensende ist das große gesellschaftspolitische Projekt der zweiten Amtszeit von Staatspräsident Emmanuel Macron.
Euphemistischer Begriff verschleiert düstere Realität
Der Entwurf sieht vor, das Recht auf Hilfe beim Sterben im öffentlichen Gesundheitsrecht zu verankern. Er verzichtet dabei bewusst auf Begriffe wie „assistierter Suizid“ oder „Euthanasie“. Stattdessen ist von „aide à mourir“ die Rede – einer Formulierung, die den eigentlichen Sachverhalt verschleiere, wie Kritiker dem Entwurf vorwerfen. Das Verfahren erlaubt es schwerkranken Menschen, die eine entsprechende Bitte äußern, eine tödliche Substanz entweder selbst einzunehmen oder, wenn sie dazu körperlich nicht in der Lage sind, sich durch medizinisches Personal verabreichen zu lassen. Grundsätzlich gilt dabei: Assistierter Suizid ist die Regel, Euthanasie die Ausnahme.
Der Gesetzentwurf stößt jedoch auf breite Kritik seitens medizinischer Fachverbände, Betroffenenorganisationen und religiöser Autoritäten. Eine gemeinsame Stellungnahme der Conférence des responsables de culte en France (CRCF), der Vertreter aller großen Religionen angehören, warnt vor einem „anthropologischen Bruch“. Die Integration der „aktiven Sterbehilfe“ in das Gesundheitsrecht stelle eine „Perversion der Medizin“ dar und missachte zentrale Prinzipien des Heilberufs. Kritisiert werden auch die knappen Fristen und das Fehlen verpflichtender psychiatrischer Begutachtungen.
Religionsvertreter fordern Pflege statt Tötung
„Die Einführung dieses ,Rechts‘ könnte einen subtilen, aber realen Druck auf ältere, kranke oder behinderte Menschen ausüben“, so die Religionsvertreter. Allein die Existenz einer solchen Option könne bei Patienten zu toxischen Schuldgefühlen führen – dem Gefühl, „eine Last zu sein“. In Ländern, in denen Sterbehilfe legalisiert wurde, sei außerdem ein besorgniserregender Rückgang der Investitionen in die Palliativpflege zu beobachten.
„Der Gesetzentwurf verankert die individuelle Autonomie zum Nachteil familiärer und sozialer Bindungen. Er verabsolutiert individuelle Selbstbestimmung und schließt jegliche Information oder Konsultation von Angehörigen, des Pflegepersonals und jegliche spirituelle oder psychologische Begleitung aus. Damit lässt er die relationale und interdependente Dimension des menschlichen Daseins völlig außer Acht“, warnt die Konferenz. Die Religionsgemeinschaften fordern stattdessen den konsequenten Ausbau der Palliativversorgung, die Schulung zur Begleitung am Lebensende und ein solidarisches Miteinander.
Um das Recht in Anspruch nehmen zu können, müssen laut Gesetz fünf Bedingungen erfüllt sein: Volljährigkeit, französische Staatsbürgerschaft oder stabiler Wohnsitz, eine schwere und unheilbare Krankheit in fortgeschrittenem Stadium, verbunden mit körperlichem oder psychischem Leid, das als unerträglich empfunden wird. Dabei darf psychisches Leiden allein kein Kriterium sein. Die betroffene Person muss zudem urteilsfähig sein. Menschen mit Alzheimer, psychiatrischen Erkrankungen oder im irreversiblen Koma sind ausgeschlossen, ebenso alte oder behinderte Menschen ohne weitere medizinische Kriterien.
Pflegeheime müssen Euthanasie durchführen
Die Prüfung der Kriterien obliegt dem behandelnden Arzt, der sich innerhalb von zwei Wochen entscheiden muss. Unterstützt wird er idealerweise von einem Facharzt und einer Pflegekraft – allerdings ist deren persönliche Kenntnis des Patienten nicht vorgeschrieben. Die Kosten der Maßnahme sollen vollständig von der Krankenkasse übernommen werden.
Eine Gewissensklausel erlaubt es Ärzten und Pflegekräften, die Mitwirkung zu verweigern. Nicht davon umfasst sind allerdings Apotheken und Einrichtungen wie Pflegeheime, die die Durchführung ermöglichen müssen, wenn ein Patient sie verlangt. Zudem wird ein neuer Straftatbestand eingeführt: Wer die Durchführung oder Information über die Hilfe beim Sterben behindert – etwa durch Einschüchterung oder Störungen im medizinischen Ablauf – kann mit bis zu zwei Jahren Haft und 30.000 Euro Geldstrafe belegt werden. Angehörige oder Fachkräfte, die die Entscheidung aus persönlicher oder fachlicher Sicht infrage stellen, sind davon ausgenommen.
Blick auf andere Länder: Sterbehilfe als „glitschiger Abhang“
Ein Blick auf andere europäische Länder zeigt, dass die Zahl der Fälle nach Einführung vergleichbarer Gesetze deutlich ansteigt. In den Niederlanden lag die Zahl der registrierten Euthanasien 2024 bei knapp 10.000, in Belgien bei rund 4.000 – jeweils mit deutlichen Zuwächsen gegenüber dem Vorjahr. Kritiker befürchten, dass sich dieser Trend auch in Frankreich fortsetzen könnte.
Wird der Gesetzesentwurf angenommen, wovon auszugehen ist, wird der Entwurf voraussichtlich im Herbst 2025 in den Senat eingebracht, wo die konservative Mehrheit mit einiger Wahrscheinlichkeit Änderungen in den Entwurf einbringen wird. Anschließend folgt Anfang 2026 eine zweite Lesung in der Nationalversammlung. DT/fha
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.