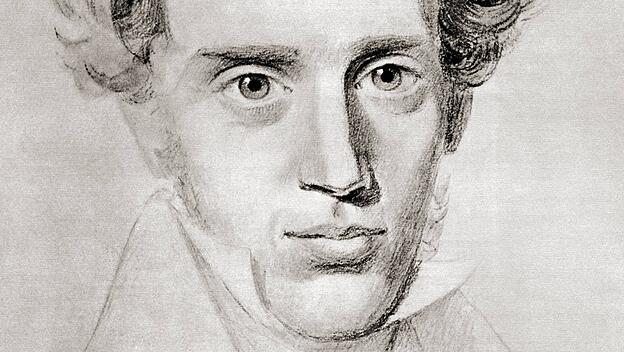Zu Holland, USA, solchen Ländern muss man wissen, bei den Puritanern schmeckt das Essen ganz beschissen. Doch bist du katholisch, Italiener und Franzos, da gibt's lecker was zu spachteln und der Wein ist ganz famos.“ Klar, das ist überspitzt, was die Kölner Kabarettisten Norbert Alich und Jürgen Becker in ihrem Lied „Ich bin so froh, dass ich nicht evangelisch bin“ singen. Aber ist nicht doch etwas dran?
Katholiken wissen zu leben
Katholiken sind gewohnt, mit Vorurteilen konfrontiert zu werden. Da ist es doch eigentlich schön, wenn hier auch mal ein positives Vorurteil angeführt wird. Es lautet: Katholiken wissen zu leben. Genuss ist so etwas wie ein Leitmotiv für einen katholischen Lebensstil. Und dann der Refrain: „Ich bin so froh, dass ich nicht evangelisch bin, die haben doch nichts anderes als arbeiten im Sinn. Als Katholik da kannst du fuschen, das Eine ist gewiss, am Samstag gehst du beichten und vergisst den ganzen Driss.“ Ist der Song nun in erster Linie als eine Hymne auf rheinisch-katholische Lebensfreude oder doch eher als Kritik an Doppelmoral und Heuchelei zu verstehen?
Kabarettisten sind keine Wissenschaftler. Sie zielen auf Lacher ab, nicht auf Erkenntnis. Also muss sie die doppelte Lesart ihrer Texte nicht weiter stören. Ist doch bloß Unterhaltung. Trotzdem müssen Katholiken hier hellhörig werden. So sympathisch das Bild, das hier von ihnen gezeichnet wird, auf den ersten Blick zumindest wirken mag, für die eigentliche Quelle der katholischen Lebensfreude haben die Kabarettisten mit ihrem Satire-Song keinen Sinn. Ihre Analyse geht nicht in die Tiefe, ihnen reicht die Karikatur.
Festtage müssen sich im Speiseplan niederschlagen
Katholische Lebensfreude hängt mit Lebenskunst zusammen. Es geht um die Kunst, die Zeit zu gestalten. Jeder Mensch ist, wenn man so will, in die Zeit geworfen. Tag folgt auf Tag, Woche auf Woche, Jahr auf Jahr. Es besteht die große Gefahr, in diesem Alltag zu versinken. Diese Herausforderung stellt sich jedem Menschen. Der Katholik verfügt aber über ein hervorragendes Hilfsmittel: den liturgischen Kalender. Hier erkennt er, dass die Zeit geordnet ist. Nicht jeder Tag ist gleich. Und damit stellt sich auch für jeden Tag eine andere Gestaltungsaufgabe. Festtage heben sich aus dem Alltag heraus – und das soll sich selbstverständlich im Speiseplan widerspiegeln. Die Devise dazu hat die heilige Therese von Avila formuliert: „Wenn Fasten, dann Fasten, wenn Truthahn, dann Truthahn.“
Und natürlich muss die Festspeise nicht immer Truthahn heißen, man kann auch mit einem Chartreuse anstoßen. Das ist ein französischer Kräuterlikör, der von den Kartäusermönchen der Großen Kartause bei Grenoble schon seit Jahrhunderten hergestellt wird. Das geheime Rezept ist immer nur drei lebenden Mönchen bekannt. Oder mit einem Kir Royal. Der Aperitif ist nicht nur nach einem Geistlichen benannt, der französische Kanoniker Félix Kir (1876-1968) hat das Rezept für den berühmten Cocktail auch selbst entwickelt. Bei Empfängen ließ der Priester für seine Gäste zwei Spezialitäten aus seiner Burgunder Heimat miteinander mischen: Schwarzen Johannisbeerlikör mit Weißwein.
Schöpfung schmecken, anstoßen mit den Heiligen
Diese zwei Beispiele – die Liste ließe sich noch natürlich noch vielfach erweitern – beweisen, die katholische Genusskultur ist nichts Abstraktes, sondern es geht um die Praxis. Sie ermöglicht den Gläubigen, die Schönheit der Schöpfung nicht nur mit Worten zu loben, sondern sie zu schmecken. Aber dieser sinnliche Genuss erschöpft sich nicht im Irdischen. Er lenkt den Blick nach oben. Der Gläubige soll auf den Geschmack kommen. Ein Vorgeschmack auf den Himmel.
Wie das zu verstehen ist, hat Michael P. Foly, Theologieprofessor aus den USA, in seinem Buch „Drinking with the Saints“ erläutert (Michael P. Foly, Drinking with the Saints: The Sinner? Guide to a Holy Happy Hour; leider noch nicht ins Deutsche übersetzt). „Trinken mit den Heiligen“ – das meint Foly ganz wörtlich. Wenn man etwa am Gedenktag des heiligen Thomas von Aquin sein Glas auf diesen großen Kirchenlehrer erhebe, dann trinke man nicht nur auf, sondern auch mit ihm. Foly betont, dass die Gläubigen, wenn sie die kirchlichen Feste begehen, nicht allein sind, sondern mit denen zusammen feiern, die bereits bei Gott sind. Diese Verbundenheit zu zelebrieren, ja zu kultivieren, helfe den Gläubigen dabei, „nicht traurig zu sein, sondern frohen Herzens“.
Die missionarische Wirkung der Freude
Diese Fröhlichkeit wirkt ansteckend. Und sie kann sogar eine missionarische Wirkung entfalten. „Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte“, stellte einst Friedrich Nietzsche fest und formulierte damit so etwas wie die Grundherausforderung, mit der die Missionare zu allen Zeiten konfrontiert waren: Wer über die Freude am Herrn predigt, der muss diese Freude auch ausstrahlen.
Die katholische Genusskultur macht Menschen fröhlich. Diese Lebensfreude ist deswegen attraktiv, weil sie im Kontrast zu einem Lebensstil steht, der heute weit verbreitet ist und ebenfalls vorgibt, auf Genuss abzuzielen. Er erzeugt aber nicht Fröhlichkeit, sondern Leistungsdruck. Denn dieser Genuss muss schwer erarbeitet werden. Das merkt man schon daran, dass der Begriff „Sünde“ in der Alltagssprache heute nur noch in einem Bereich vollkommen unbefangen verwendet wird.
Die katholische Genusskultur ist nichts Selbstgemachtes
Dann, wenn es darum geht, wie der Einzelne im Blick auf Gesundheit und Fitness sein Leben optimiert. Wer vom gesunden Ernährungsplan abweicht, wer die morgendliche Joggingrunde einfach mal ausfallen lässt, der sündigt. Auch diese Selbstoptimierung will Genuss ermöglichen, denn sie zielt auf Lust ab. Und diese „Sünden“ werden denn auch als Sünden gegen die Lust verstanden. Denn Lust bedeutet Abwesenheit von Schmerz.
Eine ungesunde Lebensweise zieht aber letztlich Schmerzen nach sich. Die Devise hier also: Wer genießen will, der muss sich anstrengen. Selbstoptimierung bedeutet Arbeit. Der katholische Genießer hat aber, hier stimmt tatsächlich die Zeile im Kölner Satire-Song, „mit Arbeit nichts im Sinn“. Die katholische Genusskultur ist nichts Selbstgemachtes. Es geht nicht um Leistung, um Effektivität, sondern um Anschauung. Gott hat die Zeit für uns geordnet. Er hat uns Festtage geschenkt. Wir müssen sie nur noch feiern.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.