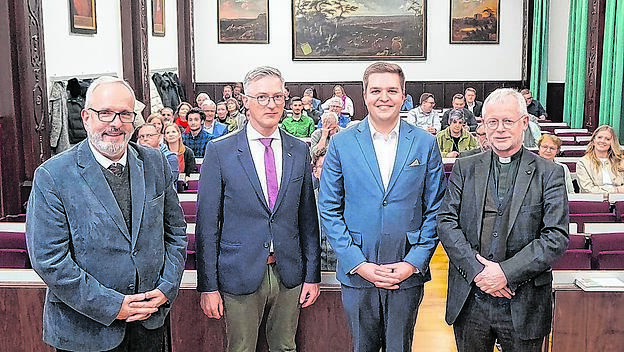Wer sich zu dem im Herbst 2021 gegründeten „Campus für Theologie und Spiritualität“ in die Hauptstadt der Republik aufmacht, muss sich auf das Gelände des St. Hedwig-Krankenhauses in der Spandauer Vorstadt in Berlin Mitte begeben.
Besonders bei Krankenhäusern hat sich das Auge bereits derart an die seelenlose Kastenoptik gewöhnt, derer sich die Gegenwartsarchitektur auch in anderen Fällen so gerne bedient, dass man ganz überrascht ist, auf ein durchweg schönes Klinikgebäude zu stoßen. Genau das ist beim denkmalgeschützten St. Hedwig-Krankenhaus, das Mitte des 19. Jahrhunderts zur Versorgung der katholischen Bevölkerung Berlins gegründet wurde, der Fall: Efeubewachsene Klinkerfassaden und neogotisches Formenspiel erfreuen das ästhetische Gemüt.
Dass der „Campus für Theologie und Spiritualität“ (CTS) gerade hier seine Heimat gefunden hat, ist kein Zufall. Denn dieser, wie es offiziell heißt: „nichtselbstständige Studienstandort“ der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster befindet sich in Trägerschaft verschiedener Orden und geistlicher Gemeinschaften, darunter auch die Alexianerbrüder, die seit 1999 das St. Hedwig-Krankenhaus betreiben.
Überhaupt ist die Kombination aus Krankenhaus und spirituellem Standort nicht so abwegig, wie es zunächst vielleicht scheinen könnte. Denn ein gesunder Geist wohnt bekanntlich in einem gesunden Körper, und umgekehrt hat die leibliche Gesundung des Menschen auch immer eine geistige oder gar geistliche Dimension.
Spirituelle Weiterbildung
So ist es nur folgerichtig, wenn der „Campus für Theologie und Spiritualität“ neben anderen Programmen – etwa einem theologischen Studienjahr für Studenten anderer Hochschulen – auch einen Weiterbildungskurs mit dem Titel „Leadership & Spiritualität“ für Führungskräfte in Einrichtungen in christlicher Trägerschaft anbietet. Mehrere hundert Führungsverantwortliche aus Kliniken in ganz Deutschland haben das Programm bereits erfolgreich absolviert, wie Pater Ulrich Engel OP, Gründungsbeauftragter des CTS Berlin, erzählt. Das Angebot zum Thema Pflege und Spiritualität soll weiter ausgebaut werden. Im Moment arbeitet man an der Entwicklung eines Bachelor-Studiengangs „Spiritual Care und Seelsorge im Gesundheitswesen“.
Perspektivisch, so ist zu hören, möchte man institutionell auf eigenen Beinen stehen. Jedoch hat man die Zeichen der Zeit erkannt: Ein weiterer Hochschulstandort mit Theologie-Vollstudium ist angesichts sinkender Studentenzahlen in der Theologie schlicht überflüssig. Pater Engel sieht die Dinge realistisch: Für die erfolgreiche Verkündigung des Christentums, wie sie Papst Franziskus immer wieder fordert, seien heute nicht mehr zwangsläufig Kenntnisse des Griechischen oder Hebräischen notwendig. Stattdessen werde es immer stärker auf zwischenmenschliche, seelsorgerische Kompetenzen ankommen, gerade etwa in der Pflege.
Dass bei aller Praxisorientierung auch die intellektuelle Arbeit ihren Platz am CTS hat, beweist etwa der jüngst abgehaltene dreitägige Meisterkurs zum Thema „Meister Eckhart und Marguerite Porète“. Als Referenten sind drei Koryphäen der Eckhart-Forschung geladen: der emeritierte Augsburger Mediävist Freimut Löser, der emeritierte Tübinger Moraltheologe Dietmar Mieth sowie Markus Vinzent, Professor für Religionswissenschaft am Londoner King? College und derzeit Leiter der Meister-Eckhart-Forschungsstelle am Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt.
Klassiker der Mystik
Das Thema scheint Jung und Alt gleichermaßen anzusprechen. Unter den rund zwanzig Teilnehmern gibt es einige, die ihr Berufsleben allem Anschein nach schon hinter sich haben. Anwesend sind beispielsweise aber auch drei junge Dominikaner, die im Gegensatz zu den in Zivil gekleideten Ordensprofessoren gut an ihrem weißen Habit zu erkennen sind.
Im Laufe des ersten Nachmittags wird schnell klar, worin die große Schwierigkeit besteht, wenn man sich über Denker wie Eckhart oder seine heute weniger bekannte Zeitgenossin Marguerite Porète austauschen möchte: Die Texte dieser Mystiker entziehen sich dem analytischen Zugriff und reizen zur freien Assoziation, was wiederum die Gefahr mit sich bringt, dass die an der Diskussion Beteiligten eher um den Ausdruck ihrer subjektiven Empfindungen als das gemeinsame Verstehen der Sache selbst ringen.
Für den öffentlichen Abendvortrag ist ein Ortswechsel vorgesehen: Mit Bus und Bahn machen sich die Teilnehmer vom Tagungsort auf den Weg zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz. In der überschaubaren Kapelle nebenan kommen die Teilnehmer des Kurses sowie weitere interessierte Zuhörer zusammen, um den Ausführungen Dietmar Mieths zu „Mystik als Selbstzurücknahme“ bei Meister Eckhart und Marguerite Porète zu lauschen.
Marguerite Porète und die "Annihilation“ der Seele
Mieth präsentiert Eckhart und Porète als Geistesverwandte, die in zentralen Motiven ihres Denkens übereinstimmen: Statt um moralischen Aktivismus geht es darum, die richtige Art von Passivität und Gelassenheit zu entwickeln. Dazu müsse man das eigene Ego in seinem Geltungs- und Tatendrang zurücknehmen, um so frei zu werden für das Wirken Gottes. Besonders radikal ist dabei Porète. In ihrem „Spiegel der einfachen Seelen“, der vermutlich Ende des 13. Jahrhunderts verfasst wurde und im Laufe des Mittelalters weite Verbreitung fand, spricht die Autorin, die der Laienbewegung der Beginen angehörte, sogar von der Selbstvernichtung, der „Annihilation“ der Seele.
Dass diese beiden schwer zugänglichen Mystiker des Mittelalters auch in Zeiten des „Spiritual Care“ praxistauglich sind, zeigt sich in der Diskussion: Eckhart und Porète folgen in ihrem Denken einer Logik des Woraus, statt einer Logik des Worumwillens. Das heißt: Nicht auf den Nutzen unseres Handelns kommt es an, sondern auf die Quelle, woraus sich dieses speist. Die geistige Abkehr vom instrumentellen Denken in Zweckmäßigkeiten und Machbarkeiten könnte – so paradox es klingt – den größten Nutzen mit sich bringen, ob es nun um die Bewahrung der Erde oder den Umgang mit kranken Menschen in Pflege geht.
Trotz oder Demut?
Mieth, der einen Roman über das Schicksal Porètes verfasst hat, versteht es an diesem Abend auch, die biographischen und zeithistorischen Hintergründe geschickt in seinen Vortrag einzuflechten: Porète gerät wie Eckhart ins Visier der Inquisition. Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden ist ihre jeweilige Reaktion auf diese Bedrohung: Während Eckhart kooperiert, verweigert sich Porète total. Sie ist nicht bereit, sich für ihre kontroversen Thesen zu rechtfertigen oder die als häretisch verurteilten Aussagen aus ihrem Werk zu widerrufen. Stattdessen schweigt sie gegenüber der Inquisition. Am 1. Juni 1310 wird die exkommunizierte Porète als hartnäckige Ketzerin in Paris bei lebendigem Leib auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Eckhart dagegen ist bereit, sich pauschal von allen Irrtümern zu distanzieren, die man ihm nachweisen könnte. Gegen ihn selbst wird daher nie ein Urteil als Häretiker verhängt; lediglich einige Sätze aus seinem Werk werden als ketzerisch verurteilt.
Wer den Ausführungen Mieths aufmerksam zuhört, dem drängt sich unweigerlich die Frage auf, wie die trotzige Weigerung Porètes, sich der kirchlichen Hierarchie zu unterwerfen, mit ihrer Lehre der gelassenen Selbstzurücknahme zusammenstimmt. Kommt in ihrem Verhalten letztlich nicht das unheilvolle „Non serviam“ zum Ausdruck? Der Scheiterhaufen existiert heute erfreulicherweise nicht mehr. Die auf der mystischen Tradition aufbauende Spiritualität dürfte aber auch heute vor der besonderen Herausforderung stehen, dass ihre luftigen und oft schwer greifbaren Gedanken sich nicht zu weit vom sicheren Hafen der kirchlichen Lehre entfernen.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.