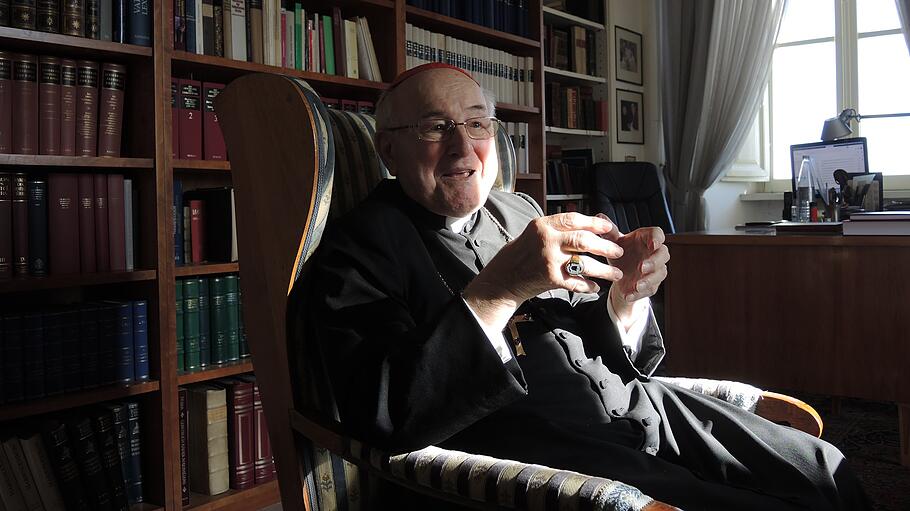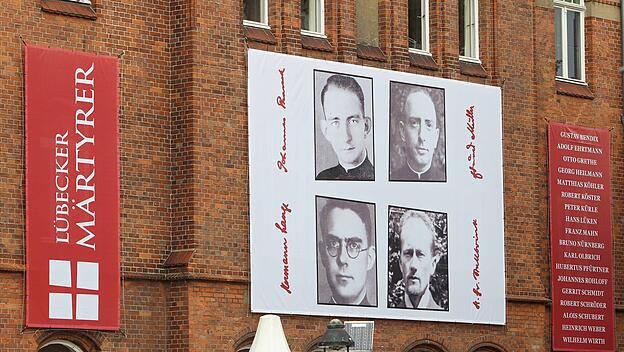Der Untergang des westlichen Imperium Romanum, wie die durch die Völkerwanderung hervorgerufenen Umbrüche betrafen auch die Kirche Mitteleuropas – die Britischen Inseln wie auch die Iberische Halbinsel blieben davon im Wesentlichen unberührt. Nicht so Italien, das vorzügliche Ziel der Migration aus Nord und Ost.
Ein verwilderter Klerus, Bischöfe, die Mörder und Ehebrecher waren
Folge davon war ein weitgehender Zusammenbruch der spätantiken lateinischen Kultur – und damit des kirchlichen Lebens. Dies galt auch für jenes Germanien, wohin im Jahre 718 der englische Mönch Winfried/Bonifatius von Papst Gregor II. als Missionar gesandt wurde. Dort waren die Reste des spätantiken Christentums vielfach im Chaos untergegangen. Der aus dem hochstehenden kirchlich-kulturellen Milieu seiner Heimat kommende Mönch sah sich dort alsbald Verhältnissen gegenüber, die ihm den Atem raubten. Ein verwilderter Klerus, Bischöfe, die Mörder und Ehebrecher waren, gehörten zu seinen Anfangserfahrungen, wie sein erhaltener Briefwechsel bezeugt.
Im Falle von Missachtung Kerker und Geißelung als Strafe
Hierbei kam dem „Concilium Germanicum“ des Jahres 742 entscheidende Bedeutung zu. Unter der Leitung des heiligen Bonifatius und des fränkischen Hausmeiers Karlmann wurde – neben anderen Reformmaßnahmen – auch der Zölibat von Priestern eingeschärft, und im Falle von Missachtung Kerker und Geißelung als Strafe verhängt. Mit diesem Konzil war der Grund gelegt, auf dem eine Generation später Karl der Große mit seinem stupenden Reformwerk, das man heute als „Karolingische Renaissance“ bezeichnet, aufbauen konnte.
DT
Wie es im dunklen Mittelalter zu einer Rückbesinnung auf das Wesen des Priestertums kam, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Tagespost“ vom 18. April 2019.