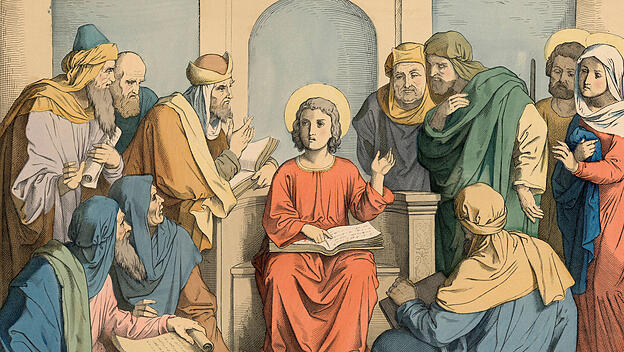Von wegen „Familienland Bayern“: Es ist genau ein Jahr her, dass Bayern Eltern mit kleinen Kindern nur noch die Hälfte des bisherigen Familiengelds zahlt, das Krippengeld gestrichen und das Landespflegegeld auf die Hälfte reduziert hat. Mit seinem neuen Kurs in der Familienpolitik droht Bayern nun endgültig vom Familienland zum „Betreuungsland“ zu werden. Man muss sich nur auf der Zunge zergehen lassen, was die bayerische Landesregierung in dieser Woche verkündet hat:
„Wir verzichten auf das geplante Kinderstartgeld, schaffen das Krippengeld ab, stellen das Bayerische Familiengeld für ab dem 1. Januar 2025 geborene Kinder ein und investieren die freiwerdenden Mittel vollständig in die Betriebskostenförderung von Kindergärten, Kitas und anderen staatlich geförderten Betreuungseinrichtungen.“
Mit Finanzierung von Kitas greift Familienförderung zu kurz
Mit anderen Worten: Mehr Geld für Betreuungseinrichtungen – weniger Unterstützung für Eltern, die ihre Kinder selbst erziehen wollen. Dabei zeigen Studien, etwa von der Bertelsmann Stiftung, wie dringend Familien finanzielle Entlastung benötigen. Doch der Freistaat scheint dieses Problem auf seine Weise lösen zu wollen: Gebt eure Kinder in Fremdbetreuung, geht arbeiten – dann kommt das Geld schon rein. Und der Staat profitiert gleich mit. Wirklich?
Familienförderung darf sich nicht in der Finanzierung von Kitas erschöpfen. Sie beginnt dort, wo Kinder Vertrauen, Geborgenheit und Bindung erfahren – in der Familie, bei den Eltern. Keine noch so gut ausgebildete Fachkraft kann elterliche Zuwendung und Bindung, schon gar nicht die selbstlose Hingabe einer Mutter, ersetzen.
Politik bevorzugt elterliche Tätigkeit in der Wirtschaft
Natürlich sind gute Betreuungsangebote wichtig – niemand will Erzieherinnen und Erzieher gegen Eltern ausspielen. Aber zwischen beiden gibt es einen Unterschied. Die Politik bevorzugt hier eindeutig die elterliche Tätigkeit in der Wirtschaft, nicht in der Familie. Zudem besteht echte Wahlfreiheit für Familien nur dann, wenn beide Wege – häusliche Erziehung und außerhäusliche Betreuung – gleichermaßen wertgeschätzt und gefördert werden.
Eltern, die sich bewusst dafür entscheiden, ihre Kinder in den ersten Lebensjahren selbst zu begleiten, ihre Entwicklung hautnah zu erleben und ihnen Liebe, Werte und Orientierung zu vermitteln, leisten einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Zudem gehört es längst zum Allgemeinwissen, dass die ersten Lebensjahre für die Bindung und Entwicklung eines Kindes entscheidend sind.
Egoismus und Utilitarismus
Doch die Politik zeigt einmal mehr: Der Beitrag der Eltern – insbesondere der Mütter – wird kaum anerkannt und schon gar nicht angemessen unterstützt. Stattdessen scheint das Ziel zu sein, die Kassen des Freistaats zu füllen. Frauen sollen Kinder bekommen – aber bitte so, dass sie möglichst schnell wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das ist nicht nur widersprüchlich, sondern fast zynisch.
Das ist Egoismus und Utilitarismus. Und es widerspricht dem Grundgesetz. In Artikel 6 heißt es, dass Eltern das vorrangige Recht und die Pflicht haben, ihre Kinder zu erziehen. Der Staat darf nur eingreifen, wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist. Kindererziehung ist also grundsätzlich Angelegenheit der Familie, nicht primär des Staates oder externer Einrichtungen. Staatliche Betreuung, Kitas oder Fördermittel sollen die Rolle und Erstverantwortung der Eltern unterstützen, nicht ersetzen oder gar finanziell benachteiligen.
Neuer Sozialismus
Wenn öffentliche Mittel vor allem in Betreuungsstrukturen fließen und Eltern faktisch in die Erwerbsarbeit gedrängt und Kinder zu Betreuungsobjekten werden, hat das mit Wahlfreiheit nichts mehr zu tun. Wer sein Kind selbst erzieht, schaut künftig in die Röhre.
Gerade ein Freistaat, der sich christlich nennt, sollte die Familie nicht auf ihre wirtschaftliche Funktion reduzieren. Eltern sind keine Lückenbüßer des Arbeitsmarktes, sondern die ersten und wichtigsten Erzieher ihrer Kinder. Wer das verkennt und der Mutter die Kindererziehung und die notwendige Stabilität verweigert, rüttelt am Fundament unserer Gesellschaft - und schafft einen neuen Sozialismus.
Die Tagespost Stiftung- Spenden Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.