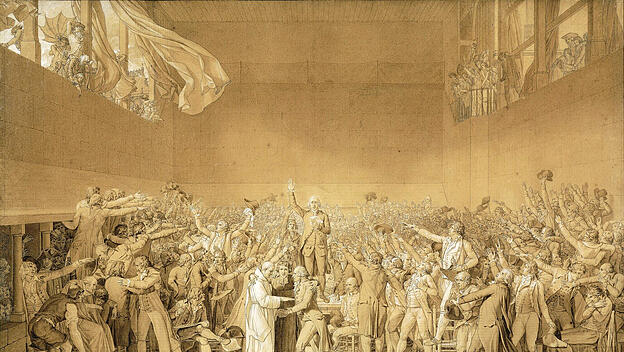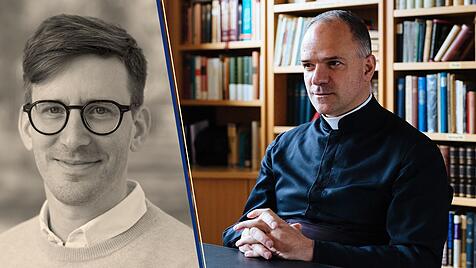Dass Klaus Bergers letztes, kurz vor seinem Tod vollendetes Werksich mit dem Schweigen beschäftigt und eine spirituell tiefgründige, intellektuell fundierte und wie immer bei Berger mit zahllosen Referenzen verwobene Theologie der Stille entwickelt, ist ein Zu-Fall mit Bindestrich. Letzten Werken kommt, wie letzten Worten, eine besondere Bedeutsamkeit zu. Und auf die nun vorliegende Theologie der Stille trifft dies in mehrfacher Hinsicht zu.
Bedeutung des Schweigens
Denn sie ist nicht nur der würdige Abschluss eines bemerkenswert umfang- und facettenreichen Lebenswerkes, sondern zugleich auch dessen stille, bescheidene und im teleologischen Sinne wegweisende Summe und Krönung. Zugleich ist „Schweigen“ ein sprechendes Signal in einer Zeit, in der definitiv zu viel geredet und zu wenig gesagt wird. Dass dies für den Einzelnen und die Kirche insgesamt schwerwiegende Folgen hat, ist eine der Lehren, die man aus Bergers Buch ziehen kann. Denn Schweigen gehört essenziell zur gottmenschlichen Begegnungskultur, weil das in Berührung kommen mit dem göttlichen Du die Möglichkeiten der Auswortung der unaussprechlich geheimnisvollen Liebesbegegnung bei weitem übersteigt.
Der für Berger so kennzeichnende und auch in diesem Buch durchgängig wahrnehmbare aphoristische Stil ist deshalb besonders passend, zeigt er doch auf, dass die Gotteserfahrung in ihren vielfältigen Ausprägungen und ihrem Bedeutungsreichtum so am ehesten aussagbar ist. Berger entfaltet zunächst die anthropologische Bedeutung des Schweigens anhand antiker Quellen, sowie der essenziellen Rolle der Stille in der Musik und der seelsorglichen Bedeutung des Schweigens, das eine so heilende, heilsame Wirkung zu entfalten vermag. Wichtig ist das zweite Kapitel, das sich unter der Überschrift „Schweigende Kronzeugen“ dem hier ganz neu und als wegweisend gedeuteten Schweigen des Zacharias und Marias widmet.
Liturgisches Schweigen
In ihm wirft Berger zudem einen neuen Blick auf den bischöflichen Dienst. Dieser werde in der Nachfolge Christi wesenhaft im Schweigen vollzogenen, was sowohl zentrierend als auch in der gegenwärtigen Situation korrigierend wirkt. Das gleiche gilt für das von der Karfreitagsliturgie ausgehende Kapitel über „Stille und Schweigen in der Liturgie“. Die offenkundigen Schwierigkeiten im Umgang mit der Stille finden ihren Raum im Kapitel „Gott schweigt“, das den Horizont der Theodizeefrage eröffnet. Der freiheitliche und befreiende Aspekt des Schweigens wird im Kapitel „Die Heimat der Stille“ thematisiert, das dessen Funktion in der christlichen Mystik entfaltet.
Die Kapitel „Schweigen der Schöpfung“ und „Sabbat und Sabbatstille“ verweisen auf den in der Schöpfung angelegten Raum für das Schweigen, der sein letztes Echo im Kapitel „Das Weltgericht in der Mitte des Schweigens“ findet. Persönlich anrührend ist das letzte Kapitel „Geheimnisse in den Herzen und auf der Zunge“, in dem erlebbar wird, dass die tiefste zwischenmenschliche ebenso wie gottmenschliche Begegnung sich in der schweigenden Berührung der Herzen vollzieht.
Klaus Berger: Schweigen. Eine Theologie der Stille. Herder, Freiburg, 2021, 200 Seiten, ISBN 978-3-451-38740-1, EUR 22, –
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.