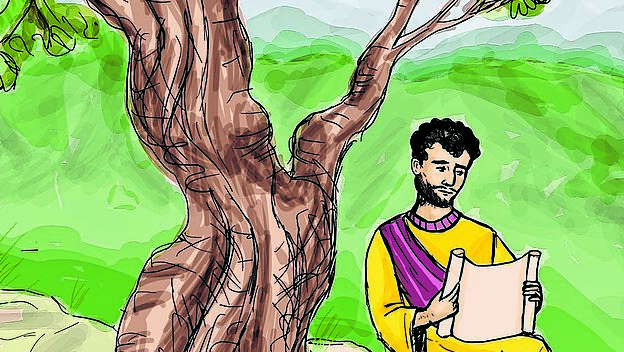Ein junger Mann sagte einmal, er könne kaum eine Minute in der Stille aushalten. Auch diesen Satz brüllte er eher heraus, als dass er ihn sprach – die Musik dröhnte so laut, dass man sonst kein Wort verstanden hätte. Lärm war seine Realität. Auf die Frage nach dem Warum gestand er: Er halte es eben nicht aus, allein mit sich zu sein. Genau dazu jedoch lädt der Aschermittwoch ein, der den Übergang von Karneval in die Fastenzeit markiert.
Manchem steckt der Karneval noch in den Gliedern: Der Kater pocht im Kopf, der Magen rebelliert, und vielleicht hängen noch Luftschlangen in den Haaren. In diesen Zustand hinein tritt der Aschermittwoch. Größer könnte der Gegensatz kaum sein. Wo eben noch ausgelassen gefeiert und das Leben zelebriert wurde, unterbricht der Aschermittwoch den Rausch – und erinnert den Menschen an seine Endlichkeit. Dafür braucht es nicht einmal die Aschermittwochsliturgie. Für den am Morgen immer noch leicht Verkaterten genügt der Blick in den Spiegel, damit so etwas wie Reue oder zumindest Ernüchterung aufkommt.
Aschermittwoch ist mehr als eine religiöse Pflichtübung
Die Ausgelassenheit des Faschings zeigt den Überfluss, von dem sich der Mensch nur ungern trennt. Allerdings fasten viele heute nicht aus religiöser Motivation, sondern aus ästhetischer oder gesundheitlicher Überzeugung. Verzicht ist zum Luxusproblem geworden. Nur wer genug hat, kann freiwillig verzichten. Wer ohnehin zu wenig hat, fastet dauerhaft. Mehr noch: Er entbehrt.
Darum ist der Aschermittwoch mehr als eine religiöse Pflichtübung. Er ist ein Moment des Innehaltens: Was brauche ich wirklich? Die Kirche setzt in der Liturgie einen besonderen Akzent: Während die Welt Unsterblichkeit durch Yoga, Achtsamkeit, OPs und grüne Smoothies verspricht, sagt die Kirche nüchtern, wer der Mensch wirklich ist: ein Sterblicher. Er wird dem Tod irgendwann unausweichlich ins Angesicht schauen.
Und damit diese Wahrheit nicht sofort wieder verdrängt wird, zeichnet die Kirche mit Asche und für alle sichtbar ein Kreuz auf die Stirn mit den Worten: „ Bedenke Menschen, dass Du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst.“ Es ist also kein Zeichen der Frömmigkeit, sondern der Sterblichkeit; eine Tatsache und ein Statement.
Hoffnung in der Asche
Die Asche stammt aus den Palmenzweigen des Vorjahres, mit denen die Gläubigen an Palmsonntag ihre Hosannarufe begleitet haben. Mit diesen Palmzweigen sind auch Begeisterung, Jubel und Triumph verbrannt. Die Kirche reibt dem Menschen buchstäblich die Asche seines Enthusiasmus ins Gesicht. Er findet sich wieder als sterbliche, erlösungsbedürftige Kreatur.
Die Kirche ist hier erfrischend realistisch. Das macht ernüchternd wirken, ist es aber nur vordergründig. Denn zugleich steckt in der krümeligen Asche ganz viel Hoffnung: Der Staub verweist auf den Schöpfer, ohne den nichts Bestand hat: kein Können, kein Wissen, keine Liebe, kein Leben, keine Hoffnung. Der Mensch mag vieles selbst machen wollen – der Staub erinnert daran, wie sehr er angewiesen bleibt. Und das ist gut so. Das entlastet.
Der Staub ist übrigens biblisch. Gott formt Adam aus Staub (Gen 2,7). Abraham nennt sich vor Gott „Staub und Asche“ (Gen 18,27), als er mit dem Höchsten über Sodom verhandelt. Hiob sitzt im Staub und hadert — und findet gerade dort zu einer Wahrheit, die trägt: „Darum widerrufe ich und atme auf, in Staub und Asche“ (Hiob 42,6). Jesus selbst sagt seinen Jüngern, sie sollen den Staub von ihren Füßen abschütteln, wenn man sie nicht aufnimmt (Mt 10,14). Hier wird der Staub sogar zum Zeugen. Er ist aber auch der Ort der Wahrheit im Angesicht des Schöpfers.
Mit dem Gesicht im Staub
Apropos: In der Bibel fallen die Menschen immer wieder zu Boden, wenn sie Gott begegnen. Johannes fällt auf Patmos wie tot hin, als er Gott begegnet (Offb 1,17). Besonders eindrücklich – und fast komisch – ist es bei Ezechiel (Ez 3,22): Der Herr ruft den Propheten hinaus auf die Ebene. Kaum ist Ezechiel dort, fällt er erstmal auf sein Gesicht. Ende der Begegnung? Keineswegs. Sie beginnt genau dort. Es ist kein „Staub fressen“, sondern der Anfang des Verbleibens in der Gegenwart Gottes. Der Mensch hört auf, sich selbst zu rechtfertigen und beginnt, sich Gott und seinem Wirken zu überlassen, sich ihm anzuvertrauen.
So wird der Aschermittwoch zu einer liturgischen Niederwerfung. Der Mensch wird auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen. „Staub bist du“ ist das verbale Pendant zum Hinfallen — und die Einladung, sich für die Herrlichkeit Gottes zu öffnen. Die Fastenzeit lädt ein, weniger zu konsumieren und stattdessen intensiver die Gottesbegegnung in der Stille zu suchen; dabei sich selbst und die eigene Beschränktheit besser zu erkennen; demütig, nicht selbstabwertend; dankbar für einen Gott, der nach jedem Fall auffängt und wieder aufrichtet.
Feuer als Medium der Gottesbegegnung
Zurück zur Asche: Sie ist verbranntes Material. Sie ist durch Feuer gegangen. Im Alten Testament ist Feuer oft das Medium der Gottesbegegnung: der brennende Dornbusch (Ex 3), die Feuersäule in der Wüste (Ex 13,21), die Feuerzungen zu Pfingsten (Apg 2). „Unser Gott ist verzehrendes Feuer“, heißt es im Hebräerbrief (Hebr 12,29). Feuer kann reinigen, versiegeln, verwandeln, läutern. „Der Mensch wird durch das Leid erst gehärtet, um das Glück ertragen zu können; so wie der Ton im Feuer gebrannt wird, um Wasser fassen zu können“, sagte einst der heilige Augustinus.
In diesem Sinne ist die Fastenzeit eine Zeit, in der Gott verbrennen darf, was in uns faul ist: die Illusionen, die Lügen, ungeordnete Anhänglichkeiten. Kein Samenkorn bringt Frucht, wenn es nicht zuerst in die Erde fällt und stirbt. So wird Staub zum Material für die Auferstehung und Aschermittwoch zu einem hoffnungsvollen Neubeginn. Derselbe Gott, der aus Staub den ersten Adam formte, wird aus Staub den neuen Menschen auferwecken. Darum bekennt die Kirche im Credo: „Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.“
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.