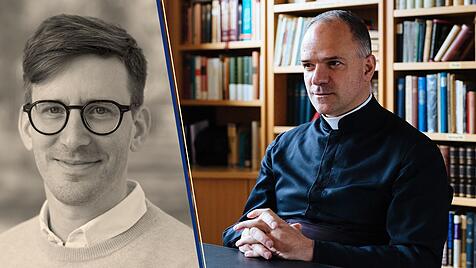Der assistierte Suizid darf nicht als „normaler Bestandteil der Gesundheitsversorgung“ betrachtet werden: Davor warnte Susanne Kummer, Geschäftsführerin des Wiener Instituts für Medizinische Anthropologie und Bioethik (IMABE), am Dienstagabend bei einer Podiumsdiskussion des „Forums Neues Leben“ der Erzdiözese Salzburg im Bischofshaus. Eine solche Entwicklung führe, so Kummer, zu einer „gefährlichen Verschiebung in der Wertung von Leben, Leid und Solidarität“. Wo die Beihilfe zum Suizid als technisches oder administratives Problem verstanden werde, beginne ein Wandel in Haltung und Sprache, betonte Kummer im Rahmen der Podiumsdiskussion, die unter dem Titel „Assistierter Suizid – Selbstbestimmtes Sterben?“ stattfand.
Die Philosophin und Ethikberaterin betonte, dass Selbstbestimmung immer in Beziehung geschehe. „Freiheit ohne Beziehung ist eine Fiktion“, sagte sie. Der Mensch sei ein soziales Wesen – auch das Sterben keine Privatangelegenheit, sondern ein gemeinschaftlicher Akt, der Beziehung brauche. Wahre Autonomie könne nie rein individuell verstanden werden, sondern sei immer „relationale Autonomie“, die davon lebe, dass andere da seien.
Ältere, alleinstehende Frauen besonders betroffen
Kummer äußerte Sorge über eine schleichende Normalisierung des assistierten Suizids. Gesetze seien nie nur juristische Regelungen, sondern prägten Haltungen und Kultur. „Wo der Staat die Hand zum Suizid reicht, verändert sich die Kultur des Lebens“, sagte sie. In Ländern wie der Schweiz, den Niederlanden oder Kanada steige die Zahl der assistierten Suizide und Tötungen auf Verlangen stark an – ebenso die Zahl der Suizide insgesamt. Besonders betroffen seien ältere, alleinstehende Frauen. „Das ist kein Ausdruck von Freiheit, sondern ein leiser, schleichender Kulturwandel“, warnte Kummer. Was als Akt der Selbstbestimmung beginne, werde zu einer gesellschaftlich anerkannten Option des vorzeitigen Todes – und treffe „zuerst die Verletzlichen“.
Auch Ursula Maria Fürst, Oberärztin der Barmherzigen Brüder in Salzburg und ausgebildete Palliativmedizinerin, sprach sich entschieden gegen eine Normalisierung der Suizidbeihilfe aus. Viele Menschen, die vom Leben Abschied nehmen wollten, wünschten sich in Wahrheit „nicht den Tod, sondern das Ende von Schmerz, Einsamkeit oder Angst“, sagte sie. Palliativmedizin könne heute Schmerzen weitgehend lindern und Begleitung auf körperlicher, seelischer und spiritueller Ebene bieten. „Was Menschen am Lebensende brauchen, ist Zuwendung, keine Abkürzung“, betonte Fürst.
Die Ärztin plädierte zugleich für eine Stärkung der ethischen Kompetenz im Gesundheitswesen. „Wir dürfen die Ethik nicht zur subjektiven Note verkommen lassen“, mahnte sie. Palliative Ethik sei in allen Bereichen der Medizin notwendig. Auch müsse sich die moderne Medizin, die zunehmend von Effizienzdenken und Aktionismus geprägt sei, auf ihren eigentlichen Auftrag besinnen: „Heilen, begleiten und vorbereiten.“ Der Wunsch nach Sterben dürfe nicht automatisch zum Handlungsauftrag werden. Wenn Töten als Therapieoption im Raum stehe, verändere das nicht nur das medizinische Personal, sondern auch das Umfeld der Betroffenen.
Gegen Kultur des Wegschauens und der Tabuisierung
Beide Referentinnen warnten vor einer Kultur des Wegschauens und der Tabuisierung. Die gesellschaftliche Debatte über assistierten Suizid sei letztlich eine Frage danach, „ob wir Leid noch aushalten können – oder ob wir es als Zumutung sehen“, sagte Kummer. Fürst ergänzte: „Würde bedeutet nicht, dass jemand perfekt funktioniert. Würde bedeutet: Du bist angenommen – gerade in deiner Schwäche.“
Zum Abschluss stellten beide Expertinnen die Frage nach der ethischen Verantwortung der Gesellschaft. „Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen in Würde sterben können – ohne das Gefühl, sie müssten den assistierten Suizid wählen, um würdevoll zu sterben“, sagte Kummer. Für christliche Krankenhäuser bedeute das, eine klare Position gegen die Suizidbeihilfe einzunehmen, betonte Fürst.
Die Veranstaltung zeigte, dass die Diskussion um assistierten Suizid weit über juristische Fragen hinausgeht. Es brauche, so der Tenor des Abends, eine „Kultur des Mitgefühls, der Achtsamkeit und der Begleitung am Lebensende“. Menschliche Würde, so Kummer abschließend, hänge nicht davon ab, „wie unabhängig wir sind, sondern wie wir miteinander umgehen, wenn wir es nicht mehr sind“. DT
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.