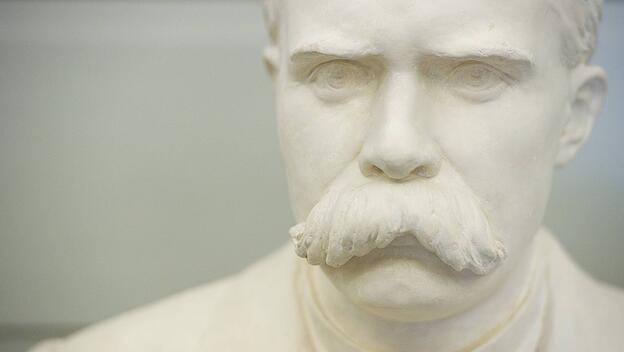Wir haben derzeit großes Verletzungspech.“ - So etwas sagen Trainer gern, wenn es nicht so läuft. Wenn wichtige Spieler ausfallen, kann einfach die Normalleistung einer Sportmannschaft nicht erreicht werden. Nachvollziehbar. Allein das Konzept „Pech“ scheint am eigentlichen Problem vorbeizugehen.
Denn Verletzungen sind fest einkalkuliert. Fußballvereine, die international spielen, haben 30, 40 Spieler unter Vertrag, auch wenn nach wie vor nur elf von ihnen auflaufen dürfen. Weil es gerade am Ende der Saison, wenn es um die nationalen und internationalen Titel geht, darauf ankommt, noch genügend einsatzfähige Mitarbeiter zu haben. Und dafür braucht es Reserven.
Der „Men’s European Football Injury Index“ weist für die Saison 2024/25 insgesamt 4456 gravierendere Verletzungen in den fünf größten Ligen Europas aus (deutsche Bundesliga, englische Premier League, spanische La Liga, französische Ligue 1 und italienische Serie A), in den letzten fünf Jahren waren es alles in allem 22.596 Fälle. Dass dies wegen des Personalausfalls vor allem als Kostenfaktor wahrgenommen wird (die Aufwendungen aufgrund dieser Verletzungen beliefen sich auf rund 3,5 Milliarden Euro), ist schon eher ein Hinweis auf die Ursache als die Rede vom ominösen „Pech“.
Auf dem Rücken der Aktiven
Wenn aus kommerziellen Gründen immer mehr Spiele stattfinden sollen, damit es möglichst keinen Fernsehabend ohne Fußball gibt, dann geschieht dies auf dem Rücken der Aktiven. Mit der Folge, dass die Erholung zu kurz kommt.
Im Fußball mag sich hier das Mitleid wegen der üblichen Millionengehälter in Grenzen halten, das Überlastungsproblem betrifft aber auch andere Sportarten.
Wenn bei der Siegerehrung der Handball-Europameisterschaft mehrere Spieler des Titelträgers Dänemark auf Krücken das Treppchen besteigen, dann ist das durchaus symptomatisch für eine extrem körperbetonte Sportart mit einem geradezu absurd engen Terminkalender, der für die Nationalspieler, die zumeist bei „Champions League“-Teilnehmern unter Vertrag stehen, rund 80 Wettbewerbsspiele pro Jahr vorsieht.
Frowin Fasold von der Sporthochschule Köln mahnte vor den Olympischen Spielen 2024 zum Umdenken und zu mehr Regenerationszeit im Handball: „Wir brauchen mehr Geduld mit Spielern, die aus einer Verletzung zurückkommen. Die Gefahr von erneuten oder zusätzlichen Verletzungen ist erhöht, wenn ein Spieler so schnell wie möglich - und damit vielleicht zu früh - wieder einsteigt. Und einen erneuten Ausfall will niemand.“ Nicht der Verein, nicht der Sponsor, nicht die Medien. Der Spieler auch nicht.
Hier ist aber auch an die Eigenverantwortung der Aktiven zu appellieren, denn neben den Zwängen des „Systems“ ist es oft genug auch der „falsche Ehrgeiz“ seitens der Athletinnen und Athleten, die unbedingt einen Karrierehöhepunkt wie Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele erleben wollen und sich für den Wettkampf „fit spritzen“ lassen. Augen zu, Zähne zusammenbeißen - und durch. Das kann gut gehen, langfristig aber auch problematisch werden.
Raus aus dem Becken, rein in die Depression
Und auch, wer das große Glück hatte, in der Karriere vom „Verletzungspech“ verschont geblieben zu sein, hat oft ein gesundheitliches Problem zu bewältigen, das aus dem Hochleistungssport resultiert. In der eigentlich sehr wenig verletzungsanfälligen Sportart Schwimmen wurden einige Superstars nach ihrer Weltkarriere mit der Diagnose „Depression“ konfrontiert, darunter Michael Phelps, Ryan Lochte, Caeleb Dressel und Adam Peaty, die zusammen 41 olympische Goldmedaillen gewannen.
Die Vitrine ist voll, der Kopf ist leer. Kein Widerspruch. Oft genug gelingt der Übergang von der großen Bühne des Weltsports, mit viel öffentlicher Aufmerksamkeit und noch mehr Geld, in die bescheidene Sphäre eines von überschaubaren Repräsentationsaufgaben geprägten Privatlebens nicht wirklich.
Jan Ullrich ist hier ein besonders tragischer Fall, aber auch andere leiden nach ihrer Karriere an der Rückkehr zur Normalität. Eine niederländische Studie zeigte vor einigen Jahren, dass vor allem Sportler, die ihre Karriere vorzeitig (etwa wegen schwerer Verletzungen) beenden mussten, anfällig für psychische Krankheiten sind.
Dasselbe gilt, wenn die Dauerbelastung bleibende Schmerzen hinterlassen hat. Es zeigt sich also, wie die körperliche Belastung des Hochleistungssports seelische Belastungen hervorrufen oder verstärken kann.
Gar nicht zu sprechen von den bekannten Athletinnen und Athleten, die vor der Zeit an den Folgen ihres Dopings verstarben, zum Teil auf, zum Teil nach der Laufbahn: die Leichtathletinnen Birgit Dressel (sie war gerade 26 Jahre jung) und Florence Griffith-Joyner (sie wurde nur 38), der immer noch die Weltrekorde über 100 und 200 Meter zuerkannt werden, die Radsportler Tom Simpson (29), Marco Pantani (34) und Jose Maria Jimenez (32) mahnen den Sport.
Die Mahnungen kommen an, auch bei denen, die den Sport organisieren und wissenschaftlich begleiten. Die Sportwissenschaft und die Sportverbände reagieren auf die Herausforderungen. Der Anti-Doping-Kampf ist eine wichtige Baustelle, vielleicht die bekannteste, aber bei Weitem nicht die einzige. Das Thema Gesundheit wird heute holistisch betrachtet.
Es gibt immer mehr Forschungsarbeiten zu nachhaltigem Training (Periodisierung, Cross-Training, Einsatz von KI in der Trainingssteuerung) und Regeneration (Kryotherapie - die gute alte „Eistonne“), aber auch zur Prävention von Verletzungen und Erkrankungen (regelmäßige Laboranalysen von Blut, Urin und Speichel).
Die Sportwissenschaft versucht mit neuesten Technologien, den Aktiven und ihrem Umfeld (Trainern, Betreuern, Physios) das nötige Rüstzeug zu geben. Zum Teil kommt so etwas dann auch im Freizeitsport an, man denke an Fitness-Tracker und das informationstechnische Monitoring von Vitaldaten (die „Pulsuhr“ als Beispiel). Die medizinische Betreuung und die Aufklärung der Aktiven über Risiken des Sports auf höchstem Leistungsniveau werden immer besser. Ernährung und Lebensführung werden sportartspezifisch optimiert. Es tut sich also was.
Unterbrechungen werden in Kauf genommen
Für die Zuschauer zeigt sich die zunehmende Achtsamkeit etwa dann, wenn Fußballspiele bei großer Hitze durch sogenannte „cooling breaks“ (Abkühl- und Trinkpausen) unterbrochen werden, um das Risiko von Kreislaufüberlastungen zu mindern. Es werden bei Kopfverletzungen auch längere Spielunterbrechungen in Kauf genommen, um sofort eine ausgiebige Behandlung zu ermöglichen. Früher durfte beim Fußball niemand ausgewechselt werden, die Spieler mussten auch unter Schmerzen bis zum Abpfiff durchhalten.
Bei der nächsten WM im Sommer dürfen in 90 Minuten bis zu fünf Spieler getauscht werden. Immer öfter signalisieren Spieler von sich aus, dass „etwas nicht stimmt“ und lassen sich vom Feld nehmen, ehe größere Verletzungen entstehen. Im Radsport wurde 2003 eine Helmpflicht eingeführt, die auch für Profis gilt und auch für Etappen mit Bergankunft. Kleine Beispiele, die zeigen, dass sich etwas ändert.
Auch die Psyche wird dabei nicht vergessen. „Mental gut drauf“ heißt längst nicht mehr ausschließlich, gute Nerven im Wettkampf zu haben, sondern auch seelische Stabilität im Leben nach dem Sport.
Fälle wie die der erwähnten Schwimmer haben hier einen Prozess angestoßen, der 2021 in das „Mental Health in Elite Athlete Toolkit“ mündete, ein hundert Seiten starkes IOC-Dokument, das Spitzensportler und ihr Umfeld für Fragen der psychischen Gesundheit sensibilisieren soll. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry wirkte daran in ihrer damaligen Funktion als Sprecherin der Athletenkommission mit, die sich innerhalb des IOC unter anderem für einen besseren Gesundheitsschutz der Olympioniken einsetzt.
Jeder ist gefragt, doch geht es nur gemeinsam
Die Organisatoren des Spitzensports können den gesundheitsförderlichen Rahmen setzen. Entscheidend ist jedoch die Selbstfürsorge der Athletinnen und Athleten. Hier hat Simone Biles, die große Turnerin aus den USA, ein beachtliches Zeichen gesetzt, als sie sich 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio vom Wettbewerb abmeldete, weil es ihr einfach nicht gut ging.
Sie war körperlich topfit, aber seelisch so belastet, dass sie die Turnübungen nicht gefahrlos hätte absolvieren können. Körper und Geist, so meinte sie, seien nicht im Einklang. Das hat sie gespürt und die Konsequenz gezogen: Verzicht auf Olympia.
Diese Sensibilität für die eigene Situation, die eben nicht nur den Körper umfasst, sondern auch Seele und Geist, ist die Grundlage für mehr Gesundheit im Hochleistungssport. Sie befähigt die Aktiven, sich gegen Tendenzen einer immer weitreichenderen kommerziellen Vereinnahmung ihrer Leistung zu wehren und Grenzen zu setzen, wenn von ihnen mehr verlangt wird, als Körper und Seele bieten können.
Der olympische Dreisprung „citius, altius, fortius“ („schneller, höher, stärker“) wurde 2021 um „communiter“ ergänzt: „gemeinsam“. Und „gemeinsam“ - das gilt auch hier. Nur in Zusammenarbeit von Wissenschaft, Verbänden, Sponsoren, Medien, Trainern und Aktiven kann das Thema Gesundheit im Hochleistungssport den ihm gebührenden Stellenwert bekommen beziehungsweise behalten.
Der Autor war Leichtathlet und mit dem OSC Berlin Anfang der 1990er-Jahre in der Bundesliga (Team-DM) aktiv.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.