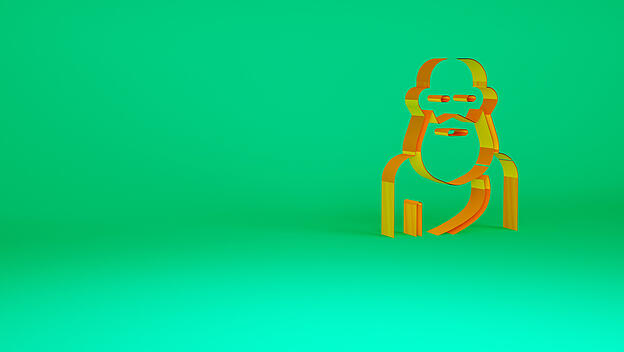Marie Luise Kaschnitz, geborene von Holzing-Berstett, entstammte einer adligen Offiziersfamilie. 1901 in Karlsruhe geboren, wuchs sie in Potsdam und Berlin als jüngste von drei Schwestern auf, die jede auf ihre Weise künstlerisch begabt war, in einer noch aristokratisch geprägten Welt und mit dem einzigen nach ihr geborenen Bruder, der endlich der Erbe der Güter sein würde. Marie Luise Kaschnitz hat zeitlebens unter dem Gefühl von Unerwünschtheit und Ungeliebtheit gelitten, und vielleicht wurde diese frühe Erfahrung für sie zum Motor ihres schriftstellerischen Schaffens.
Bezüge zur Kindheit finden sich vielfach in ihrem Werk, ja sie prägen ihre gesamte Dichtung wie eine Hintergrundfolie, auf der sich alles spätere Erleben abzeichnet. Im „Haus der Kindheit“, 1956 erschienen, erlebt die namenlose Ich-Erzählerin in teilweise phantastischen, absurd-surrealen Situationen Vorkommnisse aus ihrer Kindheit, die der der Autorin nicht nur scheinbar ähnelt. In diesem faszinierenden Text arbeitet Kaschnitz mit Verfremdungseffekten, die an Kafka erinnern. Realität und Imagination durchdringen sich, wenn sie die Erzählerin – gleichsam einem Zwang folgend – von Tag zu Tag aufs Neue in das „Kindheitsmuseum“ gehen und fast durchweg schmerzhafte und nur ganz selten beglückende Kindheitserlebnisse durchleben lässt. Im schöpferischen Wiedererleben von kindlichen Albträumen, Qualen der Einsamkeit, realen Ängsten und Spannungen befreit sich die erwachsene Dichterin vom Druck einer mehr belastenden und leidvoll als glücklich erfahrenen Kindheit.
Bei typischen „Kaschnitz-Sound“ bleibt vieles offen
Die dichterische Gestaltung ihres Lebensstoffes in gleichzeitigem Verschlüsseln und exakten Beschreiben, durch Distanzschaffen und Ichbezogenheit, Identifikation und Abgrenzung erzeugt nicht nur in diesem Werk, sondern ebenso in ihrer Lyrik und den Kurzgeschichten den typischen „Kaschnitz-Sound“, der, weil er immer so vieles offen lässt, den Leser soghaft hineinzieht ins Geschilderte und Reflektierte.
Marie Luise Kaschnitz absolvierte nach dem Lyzeum eine Buchhändlerlehre in Weimar und München. In Rom trat sie in einem Antiquariat eine Stelle als Buchhändlerin an und lernte dort ihren späteren Mann, den Archäologieprofessor Guido von Kaschnitz-Weinberg kennen. Nach ihrer Heirat 1925 wendete sich Kaschnitz intensiv der Literatur zu.
Die Tätigkeit ihres Mannes, die sie von Rom nach Königsberg (bis 1937), danach nach Marburg (bis 1941) und schließlich nach Frankfurt führte, wo Guido von Kaschnitz jeweils eine Professur innehatte, bewirkte bei Marie Luise Kaschnitz ein intensives Eintauchen in eine Welt der Wissenschaften unterschiedlichster Disziplinen. Kaschnitz war von einem enormen Wissensdurst beflügelt, so als wolle sie bisher Versäumtes nachholen. Ihr Interesse galt dabei nicht nur der Literatur, sondern ebenso der Kunst und der Mythologie, die sie sich dann auch schreibend erarbeitete. Sie schrieb beispielsweise Aufsätze über Goya, Rembrandt und Michelangelo und eine vielbeachtete Biographie über den Maler Gustave Courbet.
Marie Luise Kaschnitz: Mythologie, Kurzprosa und die Wahrheit des Kriegsschreckens
Mythologisches hat die Kaschnitz lange gefesselt, es taucht in vielen Gedichten auf und in einem eigenen Band mit Neudeutungen antiker Mythen „Griechische Mythen" (1943). Später scheint dieses Interesse in ihre Erzählungen einzugehen. Umgeformt zu hintergründig rätselhaften Momenten machen diese den unwiderstehlichen Reiz ihrer spannungsvoll aufgeladenen Kurzprosa aus, wie die in der Sammlung „Lange Schatten" (1960), die als ihr erzählerisches Hauptwerk gilt. Marie Luise Kaschnitz hat vor dem Krieg zwei autobiographisch gefärbte Romane „Liebe beginnt“ (1933) und „Elissa“ (1937) veröffentlicht. Es blieben ihre einzigen. Sie hat die Romanform nicht wieder aufgegriffen. Vielmehr wurde nach 1945 die Kurzform, ob in der Prosa, im Gedicht oder Essay ihre eigentliche Ausdrucksform. Sicherlich hat die während der Kriegsjahre erfahrene Zertrümmerung und Zerstörung nicht nur von Menschen und Orten, sondern auch von humanistischen Werten, zu einer veränderten Perspektive in ihrer Wahrnehmung von Welt beigetragen.
Bei Kaschnitz führte die nur als gebrochen erfahrene Wirklichkeit zu einem radikalen Stilwandel, weg vom klassischen gereimten Gedicht hin zur freien Metrik. Je später, desto mehr treten Verdichtung und Verknappung als prägende Stilmittel in den Vordergrund. Mit einer starken intuitiven Sprachkraft sprechen ihre Gedichte vom Schrecken des Krieges, vom Leiden der gesamten Kreatur. Eine Welt aus Asche und Trümmern breitet sich vor dem äußeren und inneren Auge der Dichterin aus, und sie kann und will nicht länger schweigen zu den Gräueln und dem verheerenden Unrecht, das der Krieg und das unmenschliche System des Nationalsozialismus verursacht haben. Kaschnitz quält der Gedanke ihrer Mitschuld, weil sie feige gewesen war und wider besseres Wissen „lieber den Arm gehoben“ hatte.
Kaschnitzs Erinnerungen an die Hitlerdiktatur und Nachkriegsbilanz
Auch in ihren späteren autobiographischen Aufzeichnungen kommt sie immer wieder auf diese traumatisierende Zeit der Hitlerdiktatur zu sprechen. Man war aus der Unschuld urplötzlich herausgefallen. Das Regime war zwar verhasst, aber Kaschnitz und ihr Mann gingen lieber in die innere Emigration, als sich am Widerstand zu beteiligen. „Lieber überleben, lieber noch da sein, weiter arbeiten, wenn erst der Spuk vorüber war.“ („Orte“) Klar, nüchtern, ohne Beschönigung beschreibt Kaschnitz diesen Vorgang in dem Gedicht „Bedrohung“: „Die ihre Häuser ohne Fenster bauen/ Kein Lichtschein nachts/ Weil Lichtschein Gefahr bedeutet/ Die ihre Ohren verstopfen/ Ihre Augen nach innen drehen/ Weil sehen und hören/ Gefahr bedeutet/ Die nicht ja sagen nein sagen/ Weil Ja-sagen Neinsagen Gefahr bedeutet/ Sie bleiben am Leben.“
In den ersten Nachkriegsjahren macht sich Marie Luise Kaschnitz an die Aufarbeitung der Kriegs- und diktatorischen Vergangenheit und warnt zugleich bereits vor einer Verdrängung des Geschehenen. „Den billigen Trost, den manche Leser vom Gedicht erwarten, habe ich nicht geben wollen“, sagt sie. Folgerichtig werden ihre Gedichte zur bitteren Anklage und Zeitbilanz. Trauer, Zorn, Entsetzen über Verfall und Tod, Zerstörung und Leid, ein Abgesang an alles Schöne – denn „das Schöne erstirbt mir unter der schreibenden Hand“ – finden in ihren Nachkriegsgedichten, die ihren Ruhm als Dichterin begründen, in immer neuen Suchbewegungen Ausdruck in einem neuen, ganz eigenen Ton: präzise, knapp, fast kühl – und gerade darin beklemmend. „So werden wir/ Du Bruder und ich/ Hinübergehen/ Schuldig./ Denn freizusprechen ist keiner.“
Romjahre, Freundschaften und bewegende Meisterwerke
In die Zeit erneuter Romjahre (1952–1956) fiel 1955 die Auszeichnung mit dem Georg-Büchner-Preis. Guido von Kaschnitz war mit der Leitung des deutschen Archäologischen Instituts in Rom betraut worden und Marie Luise Kaschnitz kehrte in die Stadt, die sie als ihre zweite Heimat bezeichnet hat, mit Freude und gewonnenem Selbstbewusstsein als bekannte Schriftstellerin zurück. Aus dieser Zeit gründete ihre bis zu deren Tod andauernde Freundschaft mit Ingeborg Bachmann. Einig waren sich die beiden Dichterinnen in der Auffassung, dass nur in der Wahrheit und Unerbittlichkeit von Sprache auch eine verändernde Wirkung im Alltags- und politischen Geschehen erreicht werden könne. 1952 erscheint ihre Erzählsammlung mit der Titelgeschichte „Das dicke Kind“. Es entsteht eine Reihe von Hörspielen, eine damals häufig gepflegte literarische Gattung. Mit Günter Eich, Wolfgang Hildesheimer und Ingeborg Bachmann prägte Kaschnitz in dieser Zeit bis hinein in die sechziger Jahre den Stil dieser Kunstform.
Dann, 1958, bereits nach Frankfurt zurückgekehrt, ereilte die Dichterin der schlimmste Schicksalsschlag ihres Lebens, der Tod ihres über alles geliebten Mannes. Der Gedichtband „Dein Schweigen. Meine Stimme“ (1962) vereinigt die unvergleichlichen, von Trauer und Schmerz über den Verlust und die Unersetzlichkeit des am meisten geliebten Menschen gezeichneten Gedichte. Nur schreibend ist es Marie Luise Kaschnitz möglich, sich tastend dem Leben wieder zuzuwenden. Es sind stilistische Meisterleistungen. Gerade in diesen Klageliedern wächst ihr poetisches Können zur Höchstform heran; ihre Fähigkeit, schmucklos und glasklar zu sprechen, die unsichtbaren Räume zwischen den Zeilen mit dem Allerwichtigsten, das ausgespart wird im Benennen, auszufüllen.
Marie Luise Kaschnitz: Schreibkunst zwischen Realismus und Phantasie
Ein besonders eindrucksvolles Gedicht aus diesem Band heißt „Auferstehung“: „Manchmal stehen wir auf/ Stehen zur Auferstehung auf/ Mitten am Tage/ Mit unserem lebenden Haar/ Mit unserer atmenden Haut.// Nur das Gewohnte ist um uns./ Keine Fata Morgana von Palmen/ Mit weidenden Löwen/ Und sanften Wölfen.// Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken/ Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus.// Und dennoch leicht/ Und dennoch unverwundbar/ Geordnet in geheimnisvolle Ordnung/ Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.“ Hier tritt auch eine Komponente in Kaschnitz' Schreiben zutage, mit der sie sich selten explizit auseinandersetzt und die doch immer wieder in Gedichten und den tagebuchförmigen Aufzeichnungen auftaucht, die Frage nach dem Glauben. Dabei war Kaschnitz vor allem an der eines Weiterlebens nach dem Tode interessiert. Mit der Schriftstellerin Luise Rinser hat sie sich mehrfach darüber unterhalten und von jener eine positive Antwort auf ihre diesbezügliche Frage erhalten. Ihre Gedichte „Nicht mutig“ und „Ein Leben nach dem Tode“ (beide in „Kein Zauberspruch“) sprechen eine deutliche Sprache. So gewiss es für sie ist, dass „Gott, täglich totgesagt, lebt und seine Liebesmacht, in die am Ende alle eingehen“, so verschweigt Marie Luise Kaschnitz ebenso wenig ihre Unsicherheiten und Zweifel, ihre Einsamkeit, Verzagtheit und Ratlosigkeit, was ihre Aussagen umso glaubwürdiger macht.
Kaschnitz war eine genaue Beobachterin. Dabei verstand sie es, Gegenwärtiges mit Vergangenem und Zukünftigem zu verbinden, in knappem Ton und nüchterner Beschreibung, oft bis zur Kargheit verkürzt. Beispielhaft sei ein Text aus „Steht noch dahin“ zitiert: „Ob wir davonkommen ohne gefoltert zu werden, ob wir eines natürlichen Todes sterben, ob wir nicht wieder hungern, die Abfalleimer nach Kartoffelschalen durchsuchen, ob wir getrieben werden in Rudeln, wir haben's gesehen. Ob wir nicht noch die Zellklopfsprache lernen, den Nächsten belauern, vom Nächsten belauert werden, und bei dem Wort Freiheit weinen müssen. Ob wir uns fortstehlen rechtzeitig auf ein weißes Bett oder zugrunde gehen am hundertfachen Atomblitz, ob wir es fertigbringen mit der Hoffnung zu sterben, steht noch dahin, steht noch dahin, steht alles noch dahin.“ Das Schwermütige war ein Wesenszug ihrer Dichtung ebenso wie die verspielte Leichtigkeit, die aber, wie Kaschnitz einmal bekannte, Produkt künstlerischer Anstrengung war. Das Geheimnisvolle, Rätselhafte, ein unauflöslicher, ungeklärter Rest sind kennzeichnend für ihre Erzählungen. Surrealistische, gespenstische, unheimliche Elemente erzeugen eine Spannung, die hineinzieht ins Geschehen der scheinbar realistisch erzählten Geschichten. Dieser rational nicht ganz aufzulösende Rest eröffnet eine andere Dimension, die wohl für Marie Luise Kaschnitz lebens- und werkimmanent ist: die Welt der Phantasie. Dass sie ihren letzten Vortrag, den sie infolge ihres unerwarteten Todes nicht mehr halten konnte, „Rettung durch die Phantasie“ überschrieb, zeigt, wie sehr sie bis zuletzt an die verwandelnde Kraft der Poesie geglaubt hat. „Dichtung, die eine Not nicht mehr wendet, wird nicht zerschlagen, sondern vergessen“, sagte sie darin.
Der Dichter soll nur das Unerwünschte sagen
„Der Dichter soll das Erwünschte verschweigen und das Unerwünschte sagen“, meinte Marie Luise Kaschnitz und hielt sich daran. Ihre Gedichte und Prosa-Aufzeichnungen sprechen von Schmerz und Tod, von Ratlosigkeit und Zweifel, Unaufgehobenheit, Zerstörungen und Verstörungen: „Halte nicht ein bei der Schmerzgrenze/ Halte nicht ein/ Geh ein Wort weiter/ Einen Atemzug/ Noch über Dich hinaus“.
Und so konnte sie nicht aufhören zu sprechen über Beschädigungen, die Menschen anderen Menschen und der Natur zufügen. In dem Text „Beschreibung eines Dorfes“ heißt es: „An meinem einundzwanzigsten und wahrscheinlich letzten Arbeitstag werde ich mich besinnen, warum ich das alles angefangen habe, diese Schilderung eines Dorfes, doch nur um Ruhe zu finden, um entlassen zu werden aus der furchtbaren Beschleunigung, aber man wird nicht entlassen, auch hier nicht, gerade hier nicht, Veränderung über Veränderung.“ Der Bericht gipfelt in der apokalyptischen Vision, dass „nach einer möglichen Katastrophe nahezu alles Leben erlischt“. Aber Kaschnitz schafft einen Spannungsbogen hin zu dem an anderem Ort geäußerten Geständnis „Ich kann von dem leidenschaftlichen Wunsch, es möge besser werden, es möge friedlicher und gerechter zugehen, nicht ablassen.“
In ihrem letzten zu Lebzeiten erschienenen Band „Orte“ formuliert Marie Luise Kaschnitz die Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit, die ihr Antrieb ist zum Schreiben: „Die Welt soll in Ordnung sein, ist aber nicht in Ordnung... Darum das Schwarzsehen, die poesie noire. Aus lauter Glücksverlangen, das aber nach und nach immer unpersönlicher wird, nicht mehr mich selber meint.“ Und da ist ja auch immer noch unausgesprochene Hoffnung, Glaubenssehnsucht und diese ihr ganz eigene offene und sie verletzbar machende Ehrlichkeit: „Was wollen wir wissen// noch wissen?// Nichts was uns selbst angeht/ Auch/ nichts von drüben/ Nur ob Frieden sein wird/ Gerechtigkeit/ Eines Tages/ Hier“ („Vulnerable").
Marie Luise Kaschnitz starb am 10. Oktober 1974 während eines Rombesuches. Sie wurde beigesetzt in Bollschweil im Schwarzwald, auf dem Friedhof des alten Herrensitzes der Familie von Holzing-Berstett an der Seite ihres Mannes.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.