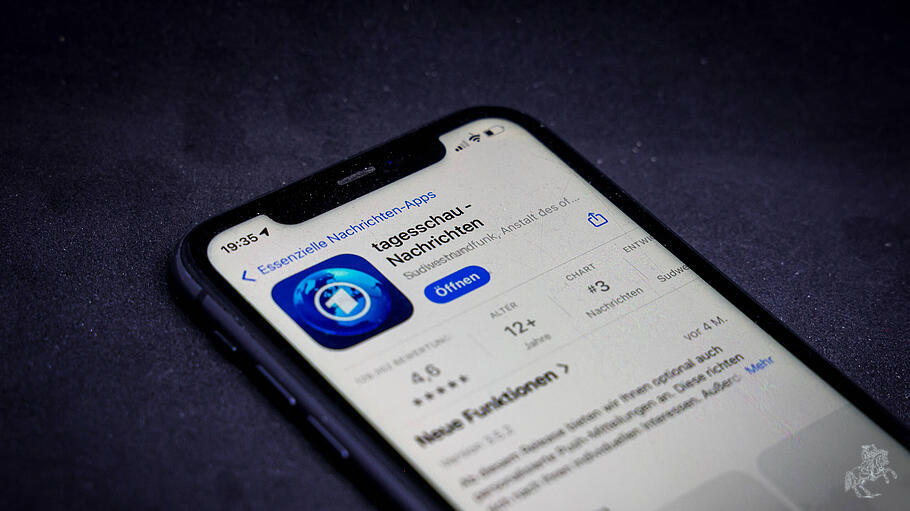Der öffentlich-rechtliche Rundfunk befindet sich in einem eigentümlichen Zwischenraum: gut finanziert, institutionell gesichert, aber geistig ausgedünnt. Die Diagnose lautet seit Jahren ähnlich – zu viel Zerstreuung, zu wenig Weltdeutung. Die Verlagerung des Programms hin zu Formaten, die primär Unterhaltung generieren, offenbart einen schleichenden Verlust an intellektueller Selbstachtung. Was Alexander Kissler einst ein Fernsehen „in weiten Teilen der Verblödung preisgegeben“ nannte, erscheint heute als Symptom einer Medienlandschaft, die ihre kulturelle Verantwortung zugunsten des algorithmischen Gefallens delegiert hat.
Die Tagesschau muss länger werden
Kurz und knapp reicht nicht mehr: Die Tagesschau muss Komplexität aushalten und mehr Tiefe bieten. Dafür braucht es mehr Zeit.