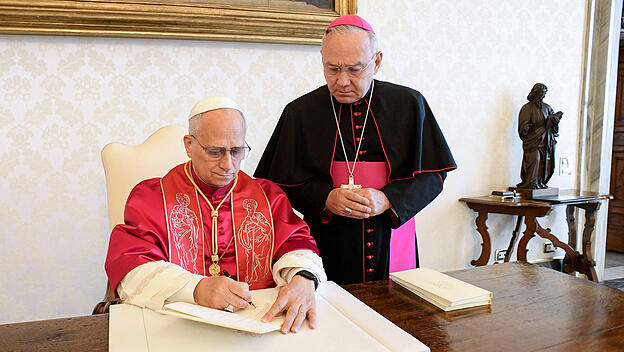In Italien hat das am Freitag vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) verkündete Urteil zu Abschiebungen von Asylbewerbern in sogenannte „sichere Herkunftsländer“ für beträchtlichen Wirbel gesorgt. Denn es geht um Abschiebelager in Albanien, die die Regierung von Giorgia Meloni eingerichtet hat, um auf dem Meer gerettete Migranten, die auf Asyl in Italien hoffen, im Schnellverfahren wieder in ihre Heimatländer abschieben zu können – wenn diese Staaten eben als „sicher“ gelten. Es ist ein Prestigeprojekt der von den „Fratelli d’Italia“ geführten Regierung und damit ein Zielpunkt heftigster Attacken der Opposition. Und das nicht zuletzt wegen der hohen Kosten in Millionenhöhe. Laut einem 2023 mit Albanien unterzeichneten Protokoll können Migranten in am Meer gelegenen Zentren in Albanien unter haftähnlichen Bedingungen untergebracht werden, bis über ihren Antrag entschieden ist, aber die Kosten dieser Strukturen – samt der aufwendigen Transporte über das Meer nach Albanien – trägt Italien.
Zum anderen ist dies ein weiterer Akt im Tauziehen zwischen der Regierung Meloni und italienischen Gerichten, die immer wieder Klagen von abzuschiebenden Migranten stattgegeben hatten, die ihre Herkunftsländer als „nicht sicher“ bezeichneten. Die jetzige Entscheidung des EuGH sei „ein Schritt, der alle beunruhigen sollte“, schrieb Meloni auf „X“. Die Justiz beanspruche Zuständigkeiten, „die ihr nicht zustehen, da die Verantwortung bei der Politik liegt“. So aber hätten nationale Richter, die sich auch auf private Quellen stützen könnten, Vorrang vor der Bewertung durch Fachminister und Parlamente. Auch der italienische Innenminister Matteo Piantedosi übte schwere Kritik an dem Urteil. Die Strukturen in Albanien würden weiterarbeiten wie bisher, jedoch zeige das Urteil auch, wie der Innenminister anfügte, dass die Anwendung des Asylrechts heute nicht mehr funktioniere. Diente es ursprünglich dem Schutz von ausländischen Bürgern vor der Verfolgung in autokratischen Staaten, werde es heute als Brücke benutzt, um unkontrolliert in reichere Länder auszuwandern.
„Sicher“ für alle Personengruppen
Der gesamte Vorgang hat eine längere Vorgeschichte und dürfte noch lange nicht abgeschlossen sein. Am 23. Oktober 2024 hatte die italienische Regierung per Dekret „unter Berücksichtigung der in den europäischen Rechtsvorschriften festgelegten Qualifikationskriterien und der Ergebnisse aus den von den zuständigen internationalen Organisationen bereitgestellten Informationsquellen“ eine Liste sicherer Länder erstellt, darunter Bangladesch und Ägypten. Diese Einstufung ist eine der Voraussetzungen für die automatische Inhaftierung und Abschiebung von Asylbewerbern. Das Dekret war nötig, um das 2023 zwischen Italien und Albanien unterzeichneten Protokolls überhaupt umsetzen zu können.
Zuvor hatte aber der EuGH am 4. Oktober desselben Jahres die Verabschiedung solcher Listen stark eingeschränkt und klargestellt, dass für die Einstufung als sicheres Land die Sicherheitslage im gesamten Land und ohne Ausnahmen für alle Personengruppen – etwa auch für Homosexuelle – gegeben sein müsse. Daraufhin hatte ein römisches Gericht am 18. Oktober 2024 die Freilassung und Zurückführung von 12 in Albanien inhaftierten Asylbewerbern aus Ägypten und Bangladesch nach Italien angeordnet, da es ihre Inhaftierung für unzulässig erklärte, weil diese Länder nach EU-Recht nicht als sicher angesehen werden können.
Mit dem gestrigen Urteil entschied nun der EuGH, dass diese Bewertungen von sicheren Herkunftsländern durch nationale Regierungen einer gerichtlichen Kontrolle unterlägen und durch klare und zugängliche Beweise gestützt sein müssten. So dürfe ein Land nicht als „sicher“ eingestuft werden, wenn es das nicht auch für bestimmte schutzbedürftige Gruppen ist.
Judikative gegen Exekutive
Die italienische Regierung wirft nun dem EuGH „Amtsmissbrauch” und der Untergrabung der nationalen Souveränität vor: Die Meinungen einzelner Richter hätten Vorrang vor den eingehenden Untersuchungen der Regierung und damit die Fähigkeit der Exekutive zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und zum Schutz der nationalen Grenzen geschwächt. Im Grunde wird die Entscheidung des EuGH von der italienischen Regierung als letzter Kraftakt einer Justiz gewertet, die ihre Befugnisse missbrauche und systematisch in die Exekutiv- und Legislativbefugnisse der einzelnen europäischen Staaten eingreife, um konservative Regierung bei einem strengen Kurs in der Handhabung des Asylrechts zu blockieren. Damit ist aber die Europäische Kommission gefragt, die klären muss, wer im Letzten über die „Sicherheit“ der „sicheren Herkunftsländer“ zu entscheiden hat. Verbliebe diese Zuständigkeit wie im Fall Italiens bei nationalen Gerichten, gäbe es keine einheitliche europäische Handhabung der Asylverfahren mehr. DT/gho
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.