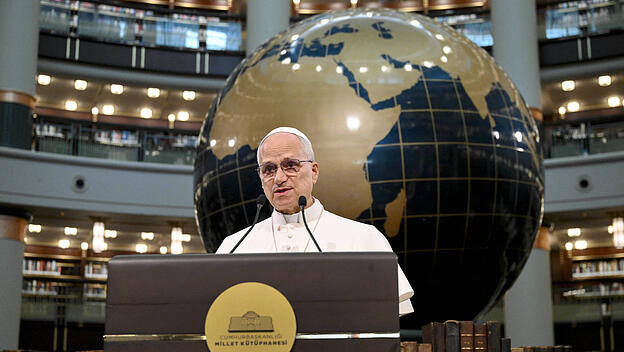Auf dem Fußballplatz des „Maccabi“-Sportvereins herrscht Stille. Noch. „Ab 15 Uhr kommen die ersten Kinder. Es gibt organisierte Busse von der jüdischen Schule hierher“, erklärt Nel, die als Werkstudentin in dem Verein die Büroarbeit unterstützt, und ihren Nachnamen nicht nennen möchte. Ab dann wird es lebhaft: Bis zu 100 Kinder und später am Abend auch Erwachsene trainieren im Laufe des Nachmittags auf den drei Rasenplätzen und in der halb geschlossenen Halle. Hochgerechnet macht das knappe 1.000 Sportler in dem Verein. Fußball, Tischtennis und Basketball, das seien die drei beliebtesten Sportarten auf dem breit gefächerten Programm. Bei kleinen Kindern stünden außerdem Tanzsportarten hoch im Kurs. „Basketball bieten wir erst seit zwei Jahren an. Da gibt es großen Zuwachs. Wir haben schon sieben Mannschaften, darunter fünf Jugendmannschaften“, erklärt Nel. Sie studiert in München Lehramt, wenn sie nicht in dem holzvertäfelten Büro des „Maccabi“-Vereins arbeitet.
Auf einem Regal sieht man dort den achtarmigen Kerzenständer, mit unbenutzten, bunten Kerzen darin. Sie werden erst zum jüdischen Chanukka-Fest angezündet. Über Nel hängen in einer Reihe Überwachungsbildschirme. Wer das Gelände betreten möchte, muss klingeln. Denn das vollautomatische, eiserne Eingangstor schiebt sich nur auf Knopfdruck zur Seite. Der Verein wird also gut überwacht. Der Grund: Seit dem 7. Oktober sei die Sicherheitslage für jüdische Bürger in Deutschland angespannter denn je. „Wir fragen wahnsinnig viel bei der Stadt und den Politikern nach Sicherheitsschutz an. Vor allem für die Auswärtsspiele“, sagt Nel. „Eigentlich sollte der bei allen jüdischen Einrichtungen automatisch gewährleistet sein. Oft muss man sich ihn aber trotzdem erkämpfen“, fügt sie hinzu.
Vor allem die Eltern sind beunruhigt
„Der Antisemitismus ist in der deutschen Gesellschaft akzeptierter als noch vor ein paar Jahren. Seien es unterschwellige Seitenhiebe oder Platzbeleidigungen, das subjektive Sicherheitsgefühl ist anders: Man fühlt sich bedrohter. Auch durch die ganzen Demos oder gar den gescheiterten Anschlag auf das israelische Generalkonsulat in München.“ Nel berichtet weiter: „ Oder einmal, da hat der Trainer einer gegnerischen Mannschaft vor einem Spiel gegen uns Drohmails bekommen. Es hieß, ihm würde etwas passieren, wenn er seine Mannschaft gegen unseren jüdischen Verein antreten lasse.“ Diese Situation habe Auswirkungen: „Wir bekommen einfach von Anschlägen mit, das beunruhigt uns. Vor allem die Eltern. Sie wollen zum Beispiel nicht mehr, dass die Gesichter ihrer Kinder auf unseren Social-Media-Kanälen sichtbar sind.“
1965 gründeten Holocaust-Überlebende in Deutschland und weltweit die „Maccabi“-Sportvereine. Der Grundgedanke: Jüdischen Kindern und Familien, die ihren Glauben praktizieren wollen, Vereinssport zu ermöglichen. Wer den jüdischen Glauben auslebt, ehrt den Shabbat, den Samstag, und treibt dann keinen Sport. Bei anderen Vereinen wären Sport und Religion nur schwer zu kombinieren gewesen. „Auch geht es darum, die jüdischen Feste zu erklären und vorzuleben. Letztes Jahr haben wir das ,Chanukka-Fest‘ gemeinsam gefeiert“, erinnert sich die junge Frau. Einer der Gründer ist der vor dem Zweiten Weltkrieg in Polen erfolgreich gewesene Boxer Jakob Nussbaum, den seine polnischen Boxfreunde vor dem Tod im Vernichtungslager retteten. Die einzelnen Trainingsplätze auf dem Münchner Sportplatz sind allesamt nach „Maccabi“-Gründern benannt. Das große Fußballfeld heißt „Kurt-Landauer-Platz“. An dem gepflasterten Weg dorthin stehen große Tafeln, die einen Überblick über die Vereinschronik geben. „Sein Enkel ist bei uns im Vorstand“, merkt Nel an und deutet auf ein Foto.
Samstags kein Sport
In 50 Ländern gibt es die jüdischen Turnvereine. Sie zählen zum Dachverband „Maccabi World Union“, dem weltweit 400 000 Mitglieder angehören. München, Warschau, Tel Aviv – in diesem Jahr feiern sie 60-jähriges Bestehen. „Bei uns ist im Frühjahr ein Ball geplant, um das Jubiläum zu feiern. Vielleicht zusammen mit der Jüdischen Gemeinde“, erklärt Nel. „Der Verein ist multikulti, darauf legen wir viel Wert. Die Religionen und Herkunftsländer sind unterschiedlich, wir haben sowohl Juden als auch Muslime und Christen hier. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine kommen natürlich ganz viele ukrainische Kids, viele von denen mit jüdischen Wurzeln“, so Nel, die selber zwischen dem Juden- und Christentum aufgewachsen ist. „Wir trainieren und spielen nicht am Shabbat, also samstags. Das schränkt uns im Ligabetrieb ein bisschen ein. Die Spielpläne werden ja von den bayerischen Verbänden gemacht“, erläutert sie den Unterschied von „Maccabi“ zu anderen Vereinen. „Auch gibt es im Vereinsrestaurant koscheres Essen.“
Das Vereinsrestaurant ist ein kastenförmiges Holzhaus und steht gleich neben dem Büro. Gegenüber befindet sich der Spielplatz, vorwiegend für die „Maccabi“-Krabbelgruppe. Am östlichen Stadtrand Münchens liegt der Verein, im Ortsteil Trudering-Riem – in einer Gegend, in der viele Familien wohnen. „Wir sind sehr familienfreundlich“, sagt Nel. Sie trägt einen türkisenen Blazer und wirft immer wieder Blicke auf die Überwachungsbildschirme. In dem Holzregal an der Wand stehen Pokale, darüber hängt ein blau-weißer Vereinsschal. Das Logo darauf zeigt den Davidstern. „Uns wurde ausdrücklich gesagt, die Vereinsanziehsachen nicht auf der Straße zu tragen, nur bei uns oder bei Spielen, also in geschützten Räumen“, erklärt die Studentin.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.