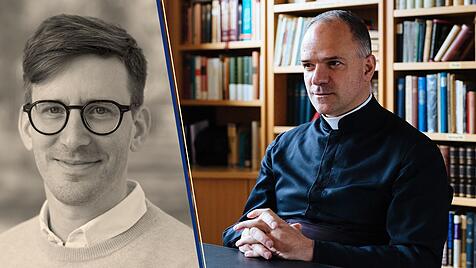Gleich doppelt beleuchtet das Feuilleton dieser Zeitung in der vorliegenden Ausgabe Zeichen einer musikalischen Krise in unserer Gesellschaft. Der Komponist Moritz Eggert schlägt Alarm (S. 17), weil sich offensichtlich sogar das öffentlich-rechtliche Fernsehen vom Gedanken verabschiedet hat, klassische Musik adäquat vermitteln zu können. Und die Musikwissenschaftlerin Dorothee Stühlmeyer, Lesern der Tagespost als Autorin seit Langem bekannt, greift eine Studie des Deutschen Musikrats zum Niedergang der Kirchenmusik auf (S. 20).
Auch wenn nach einer Studie des Deutschen Musikinformationszentrums MIZ aus 2025 immer noch über 20 Prozent der Deutschen im Alter über sechs Jahre musizieren: Die Gründe der negativen Gesamtentwicklung liegen tief. Sie berühren den Umgang mit Familie, mit Erziehung. Die Weitergabe des musikalischen Erbes als Volksgut beginnt in frühester Kindheit. Die zunehmende nichthäusliche Erziehung mit der durchgehenden Erwerbstätigkeit beider Elternteile hat an der Entwicklung einen nicht zu unterschätzenden Anteil. So gehört in der Bundesrepublik die Fremdbetreuung kleiner Kinder längst zur gesellschaftlichen Normalität. Krippen und Kindertagesstätten sind in Ost wie West flächendeckend ausgebaut, politische Programme überbieten einander in Versprechen früher Förderung. Kaum ein Kind wächst heute ohne institutionelle Betreuung auf: ein Drittel schon im Alter zwischen 0 und drei Jahren, zwischen drei und sechs Jahren sind es 95 Prozent (Stat. Bundesamt). Im Krippen- und Kita-Alltag fällt etwas auf, das kaum jemand thematisiert: Es wird erstaunlich wenig gesungen und musiziert.
Musik zum Konsumgut degradiert
Dabei ist die frühe Begegnung mit Musik einer der wirksamsten Schlüssel zur Persönlichkeitsbildung. Musik ist die Sprache der Seele, das Schlaflied von Mutter und Vater begründet emphatische Empfindungen: Hausmusik. Neurowissenschaftler weisen seit Jahren darauf hin, dass Singen, Rhythmus und elementares Instrumentalspiel die Sprachentwicklung fördern, emotionale Stabilität stärken und soziale Bindungen vertiefen. Selbsterfahrung und Gemeinschaftserlebnis: Die eigene Stimme ist das erste Instrument. Und dennoch ist ausgerechnet sie im System moderner Frühpädagogik zur Nebensache geworden. Musik wurde aus der intimen, persönlichen Erlebenssphäre verbannt und zum Konsumgut degradiert.
Der Grund liegt nicht allein in fehlendem Geld, knappen Zeitplänen oder überfüllten Gruppen. Erzieherinnen und Erzieher brauchen keine nachgewiesenen musikalischen Kenntnisse mehr. Weder Instrumentalspiel noch Gesangskompetenz sind verpflichtende Bestandteile der Ausbildung.
Dabei gab es in Deutschland ein anderes Modell – ausgerechnet im untergegangenen Staat hinter Mauer und Stacheldraht. In der DDR-Diktatur war musikalische Grundausbildung für Kindergärtnerinnen und Erzieherinnen verpflichtend. An den Fachschulen für Pädagogik gehörten Gesang, Notenlesen, Rhythmik und elementares Instrumentalspiel selbstverständlich zum Curriculum. Fast jede Einrichtung verfügte über ein Klavier oder Harmonium, viele Erzieherinnen begleiteten den Morgenkreis selbst. Musik war kein Luxus, sondern Alltag.
Man mag über die ideologische Instrumentalisierung von Liedern im Sozialismus die Nase rümpfen oder sich mit Gruseln an kämpferische Pionierhymnen erinnern. Doch jenseits politischer Zwecke wusste dieser Staat um eine pädagogische Wahrheit: Wer Kinder früh an Musik heranführt, öffnet ihnen einen Erfahrungsraum, der ein Leben lang trägt. Singen formt Gemeinschaft, schult das Gehör, schafft eine kulturelle Erfahrungswelt. Es ist eine Schule der Aufmerksamkeit und des Gefühls.
Heute hingegen delegiert man musikalische Bildung gern an externe Projekte, an gelegentliche Besuche von Musikpädagogen oder kostenpflichtige Kurse am Nachmittag. Musik wird zur Zusatzleistung, bezahlt von solventen, bildungsbewussten Eltern. Die Kita soll alles leisten – Sprachförderung, Integration, Inklusion –, da bleibt der Gesang auf der Strecke. Musik für wenige Bevorzugte in einer überwunden geglaubten Klassengesellschaft?
Kulturelle Defizite des modernen Staates
So wächst eine Generation heran, die sehr früh scheinbar professionell betreut wird, doch eine selbstverständliche musikalische Berührung findet nicht statt. Der entscheidende Faktor für ein Leben mit Musik fehlt: die tägliche, beiläufige Begegnung mit Liedern, Rhythmen und Instrumenten. Das „Musikbad“ von klein auf in den alten Kinderliedern ist Geschichte. Nicht einmal die modischen „Trad-Wives“ singen in ihren ich-bezogenen, extrovertierten Videos den Kleinsten etwas vor.
Ausgerechnet der demokratische, freiheitliche Staat hat verlernt, was ein autoritärer Vorgänger als unverzichtbar erkannte. Es ist an der Zeit, Musik wieder dorthin zurückzuholen, wo sie hingehört – an den Anfang des Lebens. Wo die Lieder fehlen, verarmt eine ganze Kultur. Musik ist, wie bereits formuliert, die Sprache der Seele. Sie erzeugt Empathie – und wo diese fehlt, sind oft Hass und Gewalt nicht weit.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.