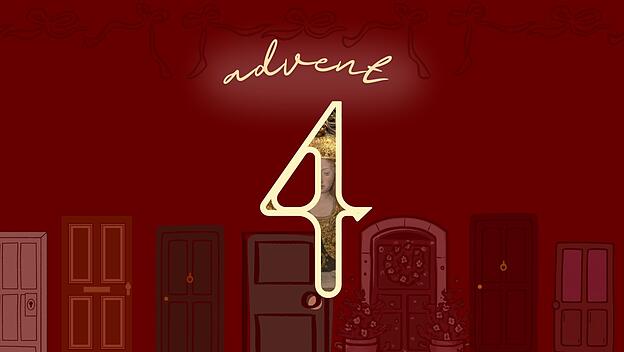Pater Simeon, welche Rolle hat die Musik in Ihrem bisherigen Leben gespielt?
Schon als Kind habe ich die Musik geliebt und begann im Alter von sieben Jahren, Klavier zu spielen. Während andere Jugendliche in der Pubertät oft mit dem Klavierspielen aufhörten, stieg meine Begeisterung und ich übte täglich mehrere Stunden. Mit 15 Jahren übernahm ich regelmäßig Orgeldienste in der Kirche. Zudem lernte ich Posaune spielen, mit der ich meinen Wehrdienst im Heeresmusikkorps 7 in Düsseldorf absolvierte und auch viel im Kölner Karneval spielte. In Köln und Mainz studierte ich Gesangspädagogik, Chorleitung und Kirchenmusik.
Wie hat die Musik Ihren Glaubensweg geprägt?
Neben der Kirchenmusik habe ich immer gerne das deutsche Liedgut gesungen, insbesondere die Lieder von Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms und Hugo Wolf. In der Schönheit auch der „weltlichen“ Musikliteratur fand ich immer eine übernatürliche und religiöse Dimension. Immer suchte ich hier die Schönheit, und damit eigentlich Gott, auch wenn mir das nicht immer bewusst war.
Nun sind Sie Zisterzienser geworden und singen vor allem den gregorianischen Choral. Welche Bedeutung hat dieser in Ihrem Klosterleben?
Der gregorianische Choral basiert textlich zu rund neunzig Prozent auf der Heiligen Schrift. Musikalisch stammt er von anonymen Komponisten, die aus der Stille der Klosterzelle am Ende des ersten beziehungsweise am Anfang des zweiten Jahrtausends das Wort Gottes meditiert haben. Der gregorianische Choral ist der musikalische Ausdruck dieser Meditation. Die Meditation der Mönche ist die „Lectio Divina“, die geistliche Lesung der Heiligen Schrift. Es ist unsere Art, mit Gott zu sprechen und zu beten. Mönche sind von ihrem Wesen her Gott Suchende, mit Gott Sprechende, Gott Anbetende.
Was macht den besonderen Reiz des gregorianischen Gesangs aus?
Der gregorianische Choral fasziniert, weil er aus der Stille der Meditation kommt. Die zu seinem Wesen gehörende Einstimmigkeit führt die Mönche in die Einheit miteinander: Man muss aufeinander hören, um wirklich einstimmig singen zu können. Es geht darum, durch den gemeinsamen meditativen Gesang zu Gott zu kommen, sich von ihm selbst, von seinem Wort und dieser Musik berühren zu lassen. Das Singen des gregorianischen Chorals ist auf diese Weise ein Sich-Ausstrecken nach Gott.
Beten ist also Singen und Singen ist Beten?
Augustinus wird der Satz zugeschrieben: „Qui bene cantat, bis orat“ – wer gut singt, betet doppelt. Aber was heißt „gut“? Ich würde sagen, gut singt, wer aus ganzem Herzen zu Gott singt, das heißt ihm sein Leben hinhält. Dabei ist es egal, ob der Gesang technisch perfekt ist oder irgendwelchen musikologisch-ästhetischen Ansprüchen genügt.

Gibt es Besonderheiten in der Art und Weise, wie die Zisterzienser den gregorianischen Choral singen?
Ja, durchaus. Zisterziensische Architektur ist relativ schlicht, aber intensiv durch Reduktion. Ähnlich ist es beim Zisterzienserchoral: eine Intensivierung durch bestimmte Reduktionen bezüglich des Ambitus, also des Tonumfangs, und der rhythmischen Komplexität.
Ist dieser besondere Choral auch in einen besonderen Ritus eingebunden?
Wir feiern die Liturgie des Zweiten Vatikanischen Konzils in lateinischer Sprache, genau so, wie es das Konzil in „Sacrosanctum Concilium“ vorgesehen hat. Wir singen die üblichen Ordinarien, das heißt: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Für jeden Sonntag, jedes Hochfest und jedes Heiligenfest gibt es aber noch eigene Stücke, die sogenannten Proprien. Diese Musik, die oft große kompositorische Qualität besitzt, ist ziemlich komplex und erfordert Kenntnis und Übung.
Müssen alle Brüder musikalisch sein, um Zisterzienser zu werden?
Die Mönche sind zwar keine professionellen Musiker, sie leben aber in dieser Musik. Neben der heiligen Messe gibt es den Choral natürlich im Chorgebet, das dreieinhalb bis vier Stunden des Tages in Anspruch nimmt. Man wächst in den Gesang hinein, selbst wenn man kein Musiker ist. Es braucht zwar einen Kantor, der alles zusammenhält, aber erstaunlicherweise entsteht auch mit vermeintlich unmusikalischen Mönchen ein berückender Gesamtklang.
Wie würden Sie die besondere spirituelle Qualität des gregorianischen Chorals beschreiben, vor allem im Kontrast zu modernen Kirchenliedern?
Der gregorianische Choral ist Gesang des Wortes Gottes in heiliger Nüchternheit und Einstimmigkeit. Er ist Gesang, der aus dem Herzen der Kirche, aus den Klöstern, aus dem Verborgenen, aus der Stille kommt. Es ist eine erstaunliche Erfahrung meines Mönchslebens, dass der Choral viele Zuhörer, obwohl sie kein Latein verstehen und die Art dieser Musik für sie fremd klingt, auf wunderbare Weise in der Seele berührt. Aus dem Wort Gottes und aus dem Herzen eines verborgenen unbekannten mittelalterlichen Komponisten spricht sich das Geheimnis bis in unsere Zeit aus. Der gregorianische Choral ist und bleibt das Tiefste und Ergreifendste der abendländischen Musikgeschichte. Alle großen Komponisten haben das erkannt.
Kann der gregorianische Choral ein Mittel zur Neuevangelisierung sein?
Ja, ich glaube fest daran. Unsere CDs haben zu beeindruckenden Zeugnissen geführt, manche jungen Mitbrüder fanden über diese CDs den Weg ins Kloster. Der Geist Gottes wirkt vielfältig und holt die Menschen dort ab, wo sie stehen. Viele suchen heute nach Einfachheit und dem Sinn des Lebens, den sie im Glauben finden können. Die Schönheit der Liturgie und des Chorals kann sie in die Beziehung zu Gott führen. Daher bin ich überzeugt, dass es in Zukunft eine Neubelebung des gregorianischen Chorals in vielen Bereichen der Kirche geben wird.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.