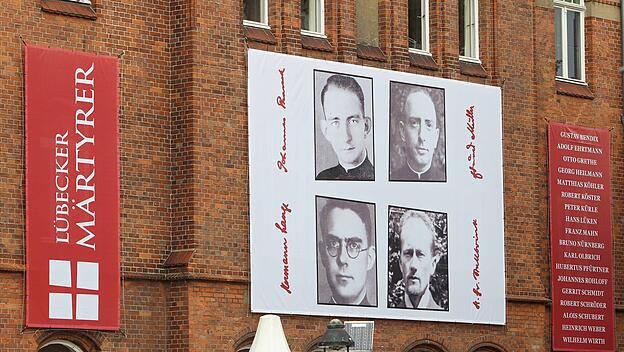Ohne Tradition geht es nicht. In der religiösen und konfessionellen Begabtenförderung zeichnet sich ein Wandel ab. So ließe sich die ein interreligiöser Diskussionsabend der Katholischen Akademie Berlin zusammenfassen. Pfarrer Markus Hentschel berichtete im Hinblick auf das Evangelische Studienwerk Villigst, Mitte der 1970er Jahre habe der Sinn der Tradition darin bestanden, vollständig aktualisiert zu werden. „Das ist zu dieser Zeit der Anspruch gewesen: Die Tradition wird verbrannt“, so Hentschel. „Was schlecht an ihr ist, geht in Flammen auf, was die Praxis befeuert, bleibt eben noch da.“ Damals habe es so viele Theologiestudenten gegeben wie nie zuvor, aber traditionelle Elemente des Glaubens wie die Feier von Gottesdiensten hätten die Stipendiaten seinerzeit nahezu vollständig abgelehnt. Tradition, so der evangelische Pfarrer, sei nicht reflektiert oder reproduziert, sondern nur kritisiert worden.
Dies habe sich allerdings in der heutigen Zeit geändert. Inzwischen gebe es wieder Gottesdienste und mehr Stipendiaten als früher, die ausdrücklich Frömmigkeitsformen forderten. „Das deute ich so, dass jetzt eine ganz andere Phase des Umgangs mit Tradition vorherrscht“, so der evangelische Theologe.
Ein umkämpfter Begriff
Milan Wehnert vom katholischen Cusanuswerk aus Bonn verwies auf den aktuellen „Bildungssommer“ des Begabtenförderungswerks, in dem es spannende Einsichten in die Traditionspflege bei jungen Menschen gebe. Man sei eine „bischöfliche Studienförderung“, und das bischöfliche Amt in der katholischen Kirche werde gemeinhin so verstanden, dass es eine ungebrochene Sukzession, also eine Nachfolge in der Tradition, seit nahezu 2000 Jahren gebe. „Das ist ein mächtiger Anspruch“, sagte Wehnert. Es sei zudem ein autoritativer Anspruch, der aus sich heraus ableite, eine rechte Auslegung von Lehre und Praxis zu verbürgen. Tradition zeige sich auch in einem sinnlich-ästhetischen Empfinden, das ebenfalls im Katholischen zu Hause sei. Kirche sei ein Raum, in dem zeitliche und geschichtliche Grenzen überschritten würden – etwa im Hinblick auf die Feier der Sakramente.
Es gebe einen scharfen kirchenpolitischen Diskurs über die kirchliche Tradition als Begriff. Von „der einen Tradition“ zu sprechen, sei bereits konstruiert. Geschichtlich gesehen habe man es mit einer Vielzahl von Traditionen zu tun. Im Reformdiskurs werde die Tradition daher als Ausschlussargument verwendet, als eine „Brandmauer gegen Reformen“. Wer sich stark auf Tradition berufe, stehe im Verdacht, autoritativ oder restaurativ zu sein. Deshalb sei der Begriff umkämpft. (DT/reg)
Der vollständige Bericht über den Diskussionsabend zur religiösen Begabtenförderung lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Tagespost.