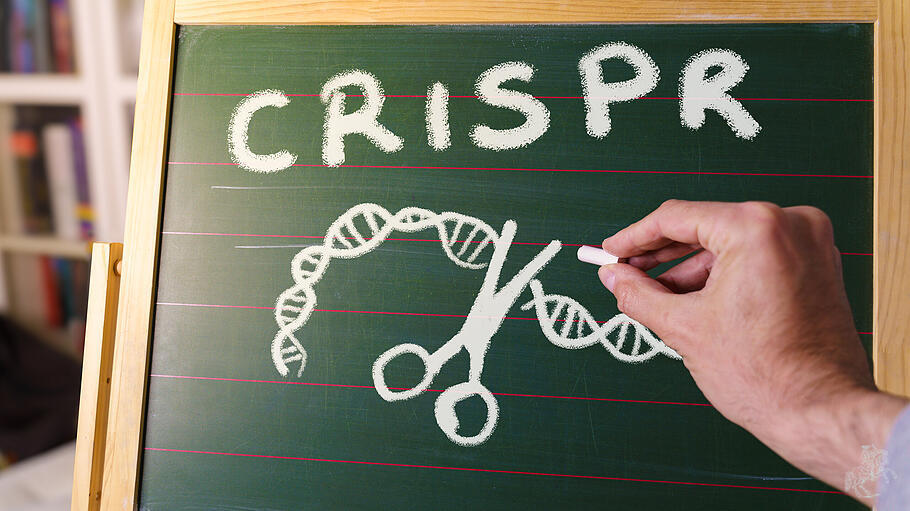Gestern hat die britische Zulassungsbehörde MHRA zwei Unternehmen aus der Schweiz und den USA eine bedingte Zulassung für das Inverkehrbringen einer gemeinsam entwickelten Therapie zur Behandlung der beiden Blutkrankheiten Sichelzellanämie und Beta-Thalassämie erteilt, bei der auf die CRISPR/Cas9-Technologie zurückgegriffen wird. Die Genehmigung ist auf ein Jahr befristet und gilt für Patienten, für die kein passender Stammzellspender gefunden werden konnte.
Kann man machen
Außerhalb des Körpers ist der Einsatz der CHRISPR/Cas9-Genschere ethisch vertretbar – Vorsicht und Aufklärung bleiben dennoch geboten.