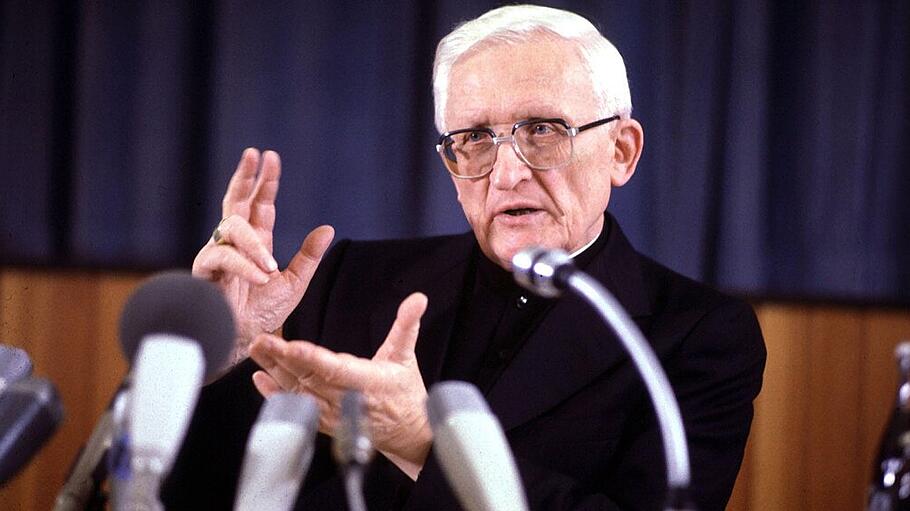Am vergangenen Sonntag war in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, im Wirtschaftsteil, ein bemerkenswerter Artikel mit der Überschrift „Der Kardinal aus Köln“ von Rainer Hank, katholisch und gebildet und verantwortlich für das Wirtschaftsressort in der FAS, zu lesen. Eine Polemik, wie er selbst schreibt, gegen die neue Enzyklika von Papst Franziskus „Fratelli tutti“, mit scharfer und intelligenter Feder verfasst.
Eine Wirtschaft, die nicht tötet
Die pauschale Kritik an der Wirtschaft in der Enzyklika „Fratelli tutti“ reizt zum Widerspruch. Eine soziale Marktwirtschaft macht lebendig, weiß unser Autor Peter Schallenberg.