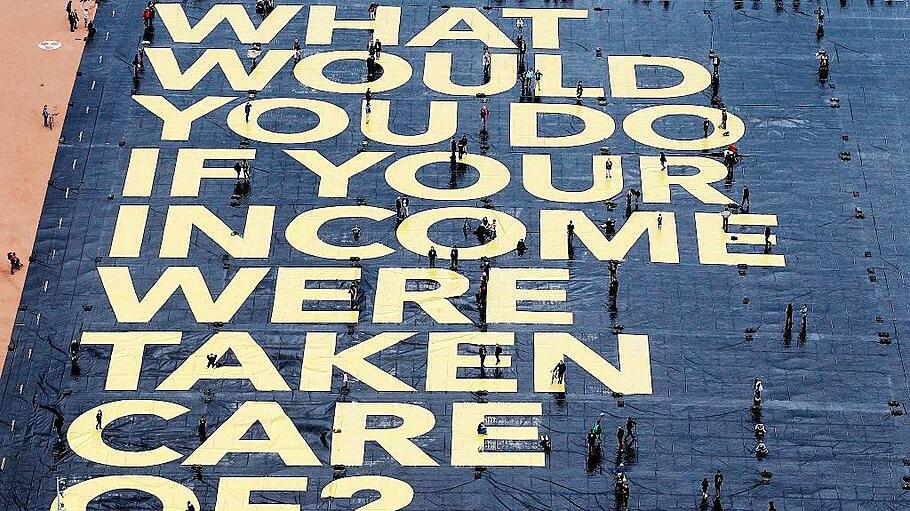Der KKV, Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung, lehnt ein bedingungsloses Grundeinkommen grundsätzlich ab, weil es nach seiner Auffassung dem christlichen Menschenbild widerspricht. Sein Credo: Die sozialste Tat ist, den Menschen wieder auf die eigenen Füße zu stellen, statt ihn auf Dauer zu alimentieren. Oder um es mit Abraham Lincoln zu formulieren: „Man hilft den Menschen nicht, wenn man etwas für sie tut, was sie selbst tun könnten.“ Die derzeitige Diskussion zum Thema „Grundeinkommen“ zeigt, dass diese Erkenntnis immer wieder in Vergessenheit gerät. Deshalb erinnern wir an eine Tugend, die heute von vielen nicht mehr gesehen wird beziehungsweise in Vergessenheit geraten ist: Die ...
Contra: Eigenverantwortung ist nicht unsozial
Warum ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt keine gute Idee ist. Von Bernd M. Wehner