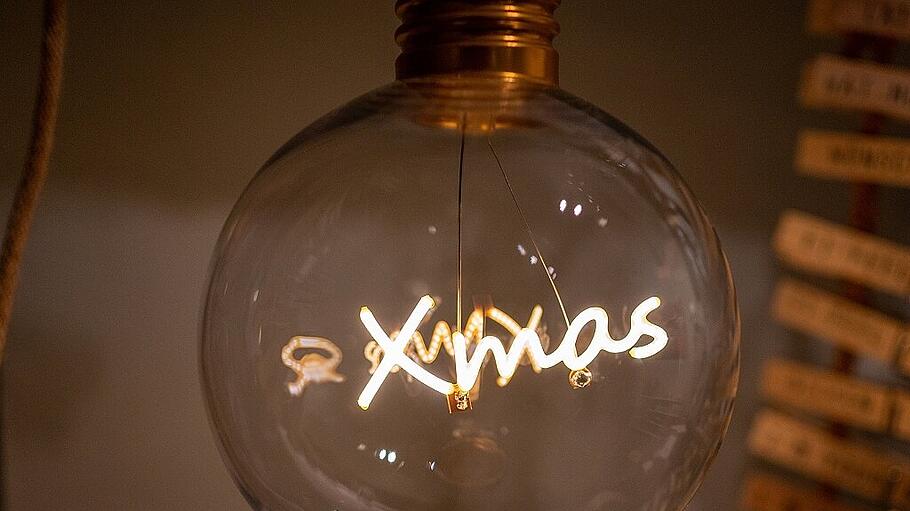X-mas“, „Fest der Liebe“, „Fest des Lichts“: Weihnachten wird inzwischen alles Mögliche genannt, was die christliche Prägung des Fests in den Hintergrund drängt. Denn viele Personen feiern zwar noch das Fest, an dem nach biblischer Überlieferung der Messias geboren wurde, aber glauben nicht mehr so richtig an dessen christliche Bedeutung. Oder sie ist ihnen schon gar nicht mehr bekannt. Doch was ist mit denen, die überzeugt an etwas anderes glauben? Wie begehen überzeugte Juden, Muslime und Atheisten diesen Tag? Wie fühlt es sich an, an einem Tag, an dem fast das ganze Land einen Festtag hat, nicht mitzufeiern?
Volksbrauchtum Weihnachten?
Viele Menschen feiern Weihnachten noch, obwohl sie gar nicht mehr an die eigentliche Bedeutung des Fests glauben. Doch wie begehen überzeugt nicht-christliche Personen diesen Tag, an dem die meisten das Hochfest feiern?