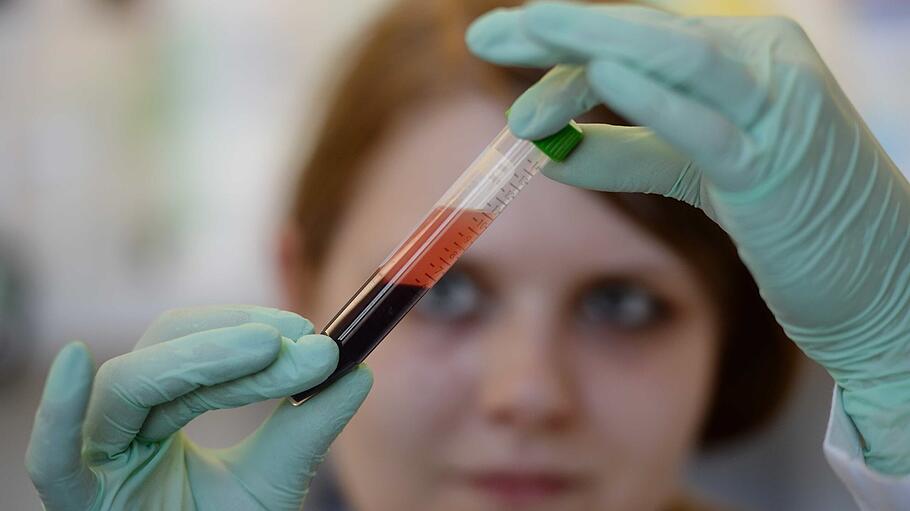Wer sich von Sprache nicht betören lässt, den dürfte die Lektüre der „Versicherteninformation“ für Bluttests auf die Trisomien 13, 18 und 21, die der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) Mitte August beschlossen hat, erst einmal sprachlos machen. Hat man die Sprache wiedergefunden, wird schnell deutlich: Das gilt sogar in doppelter Hinsicht. Im positiven wie im negativen Sinne.
Staatlicher Selbstmord
Mit der Versicherteninformation für nicht-invasive Pränataltests (NIPT) eröffnet der Staat einen Transformationsprozess, der geeignet ist, sein eigenes Fundament zum Einsturz zu bringen – Eine Analyse.