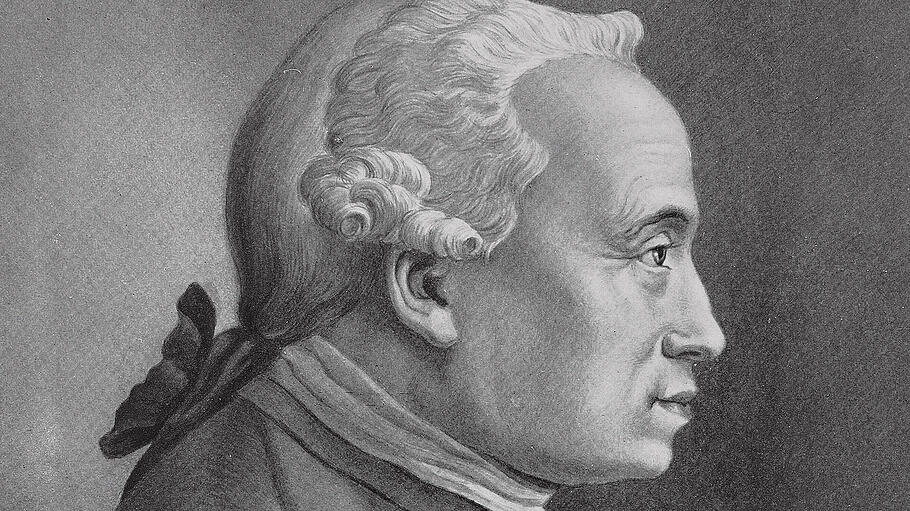Für die einen ist Kant Zerstörer, für die anderen Retter der Metaphysik. Er ist jedoch keines von beidem. Kant war der Meinung, es sei der Metaphysik noch in keiner Epoche gelungen, den Status einer gesicherten Wissenschaft zu erreichen, vielmehr präsentiere sie sich seit jeher als „Kampfplatz endloser Streitigkeiten“. Das diskreditiere diese einstmalige Königsdisziplin unter den Wissenschaften in den Augen der überaus erfolgreichen modernen Naturwissenschaft und einer davon geprägten Welt. Kant war kein Anti-Metaphysiker, im Gegenteil, sein ursprüngliches Projekt war, die Metaphysik zu retten und sie definitiv als Wissenschaft zu etablieren.
„Kritik der reinen Vernunft“: Genialer Wurf und epochale Fehlleistung
Kants Hauptwerk, die „Kritik der reinen Vernunft“, ist eine der größten Tautologien der Philosophiegeschichte.