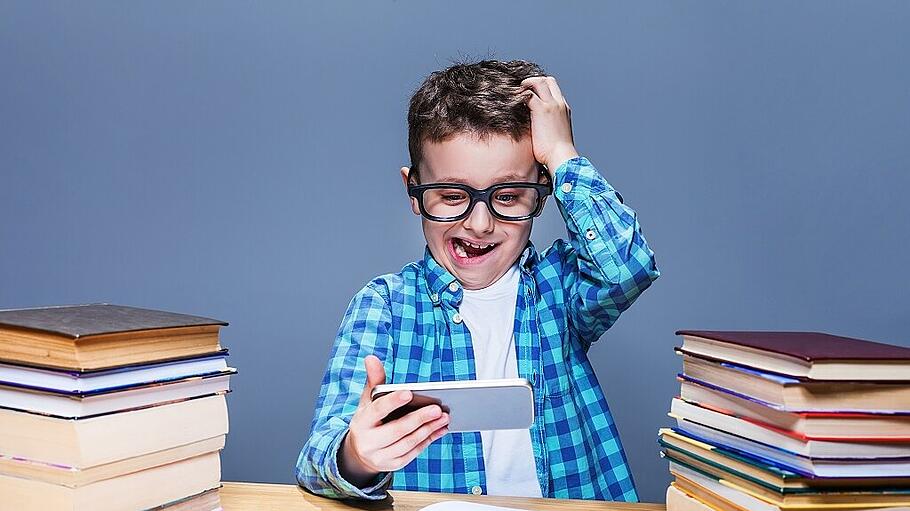Beruflich liest Andreas Gold, Seniorprofessor für Pädagogische Psychologie an der Goethe-Universität Frankfurt, fast nur noch am Bildschirm. In der Freizeit bevorzugt er für Belletristik und andere Literatur das analoge Format, nämlich das klassische Buch. Aktuell hat Gold ein flüssig lesbares Handbuch mit dem Titel „Digital lesen. Was sonst?“ veröffentlicht, das auf empirischer Basis die Möglichkeiten und Risiken digitalen Lesens vom Baby- bis zum Erwachsenenalter darstellt und den Lesern zahlreiche Tipps an die Hand gibt.
Alle Kinder lernen lesen
Oder eben nicht: Dass die Lesefähigkeit in deutschen Klassen immer mehr zur Herausforderung wird, beweisen aktuelle Studien. Wie Leseförderung im elektronischen Zeitalter aussehen kann, erklärt Leseforscher Andreas Gold.