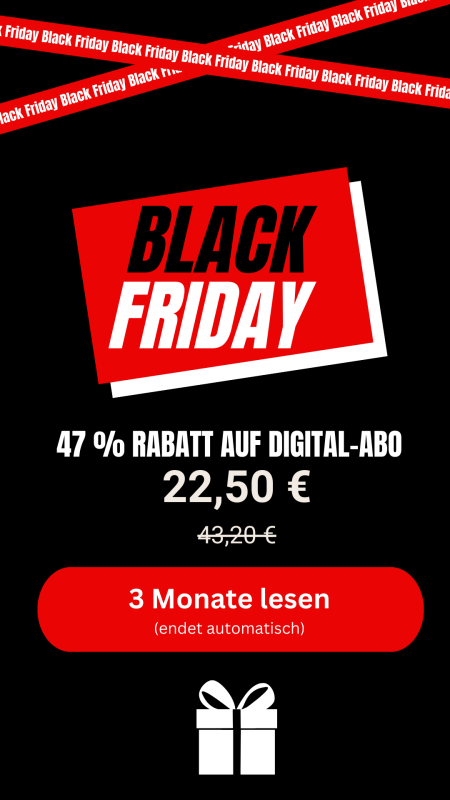Munter rollende Räder prachtvoller Karossen mag man sich vorstellen am sogenannten Damenweg, dem Chemin des Dames, benannt nach einem zum Schloss La Bove führenden Fahrweg östlich von Soissons auf dem Plateau zwischen den Tälern der Ailette und der Aisne. Er soll eigens befestigt worden sein, um den Töchtern von König Ludwig XV. die Anreisen zum Anwesen von Madame de Narbonne, einer ihrer Hofdamen, zu erleichtern. Allerdings wurde der Weg um 1783 lediglich aufgeschottert, wie man heute weiß, und 1784 ein einziges Mal von den hochadeligen Damen benutzt. Nur eine schöne Legende also, die aber in der zweimal wöchentlich erscheinenden Kriegszeitung der deutschen 7.
Aus der Tiefe, Herr, rufe ich zu dir
Die Kalksteinbrüche in der Gegend von Soissons wurden im Ersten Weltkrieg zu Festungen für Kämpfer, die dort in den Stein religiöse Zeichen, Kapellen und Altäre meißelten.