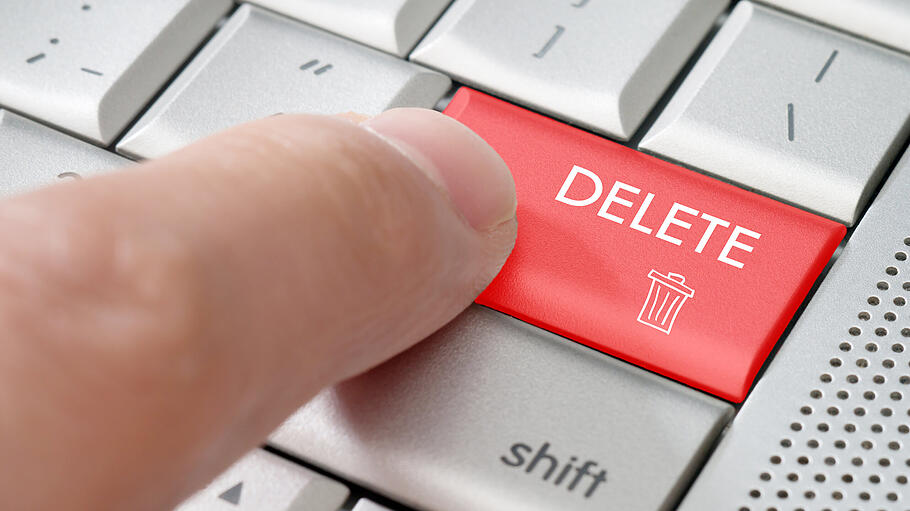Es gibt Briefe, zumal diejenigen von Otto oder Ottilie Normalschreiber, deren Inhalte zugegebenermaßen oftmals nur über eine äußerst geringe Halbwertzeit verfügen. Und dann wiederum gibt es Briefe, über deren Inhalte es sich lohnt, auch noch nach längerer Zeit zu diskutieren. Briefwechsel historischer Persönlichkeiten fallen einem hierbei ein, wie etwa derjenige zwischen Sigmund Freud und Albert Einstein über das Wesen und Übel des Krieges, der für kunstgeschichtlich Interessierte hochinteressante persönliche und intime Austausch zwischen Vincent van Gogh und seinem Bruder Theo oder der philosophisch und literarisch äußerst hochwertige Briefwechsel zwischen Voltaire und Friedrich dem Großen. Doch auch jener Offene Brief, der am 7.
Meinungen bitte nicht löschen
In einem offenen Brief verteidigen 153 weltbekannte Intellektuelle die Meinungsfreiheit und warnen vor neuen gesellschaftlichen Tendenzen der Zensur. Wie sieht es in Deutschland aus? Gibt es auch hier Gründe, sich Sorgen zu machen? Droht eine "Cancel Culture"?