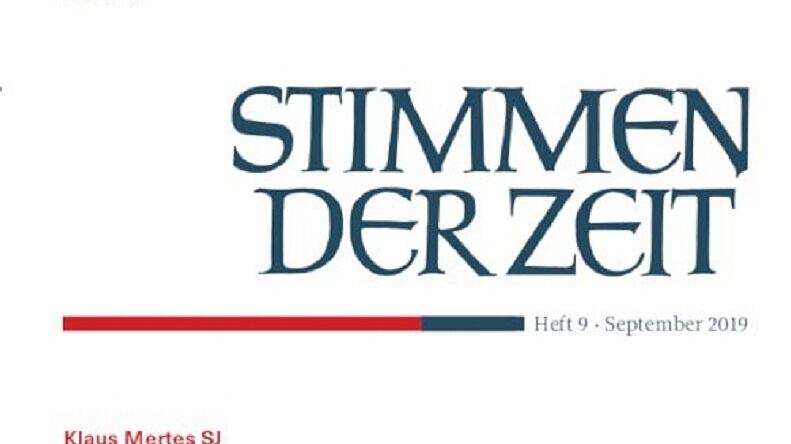Synodal Warum die in Vorbereitung begriffene deutsche Synode nicht so genannt wird, sondern umständlich als „synodaler Weg“ bezeichnet wird, hat Kardinal Marx mit seinem Antwortschreiben auf die Einsprüche der Bischofskongregation und des Rates für die Gesetzestexte offengelegt: Ein bloßer „synodaler Weg“ erlaube es, sich den Rechtsnormen, die für eine Synode gelten würden, zu entziehen. Wie von Kardinal Marx in seinem Schreiben exemplarisch vorgeführt, kann man mit dieser Strategie die kirchenrechtlichen Vorgaben und die gesamtkirchlichen Wächterdienste und dadurch die verbindliche Glaubenslehre vollkommen ins Leere laufen lassen. Ebenso strategisch wurde Frankfurt als Tagungsort bestimmt, ohne dass darüber ...
Nationale Zeitschriftenschau am 26. September
Synodal - Päpstliche Replik