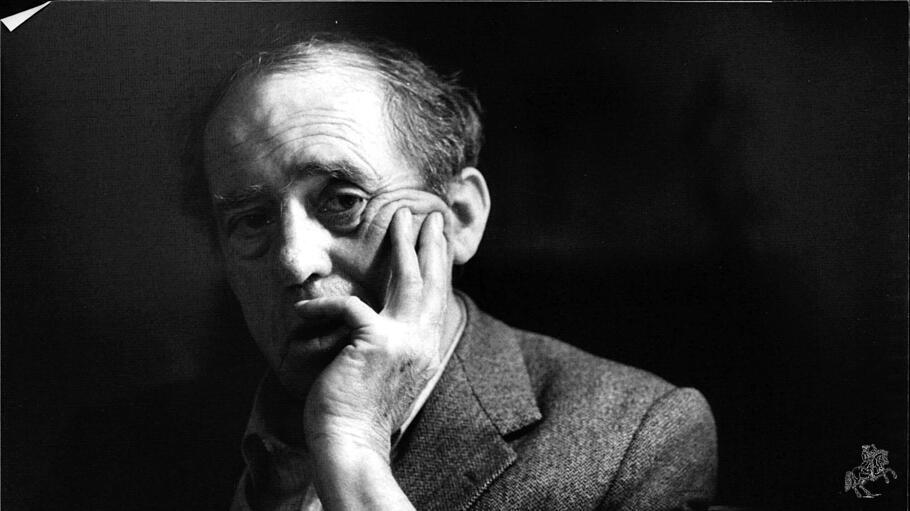Im Frühjahr 1948, ein paar Monate vor Erscheinen der ersten Ausgabe der „(Deutschen) Tagespost“ bekam ein junger Kölner Schriftsteller vom Johann Wilhelm Naumann Verlag eine Absage. Das Lektorat sah in dessen erstem Nachkriegs-Roman „Kreuz ohne Liebe“, der von den Irrungen und Wirrungen einer katholischen Familie während der Nazi-Zeit handelt, „zwar ein menschliches Dokument“ und eine „künstlerische Gestaltung“, doch die „Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus“ trete im Manuskript „zu wenig in Erscheinung“; außerdem liege „eine starke Schwarz-weiß-Schilderung“ der Wehrmacht vor.
Das Ganze gehört zusammen
Kirche und Kultur im Spiegel des „Tagespost“-Feuilletons – Plädoyer für eine katholische Weite.