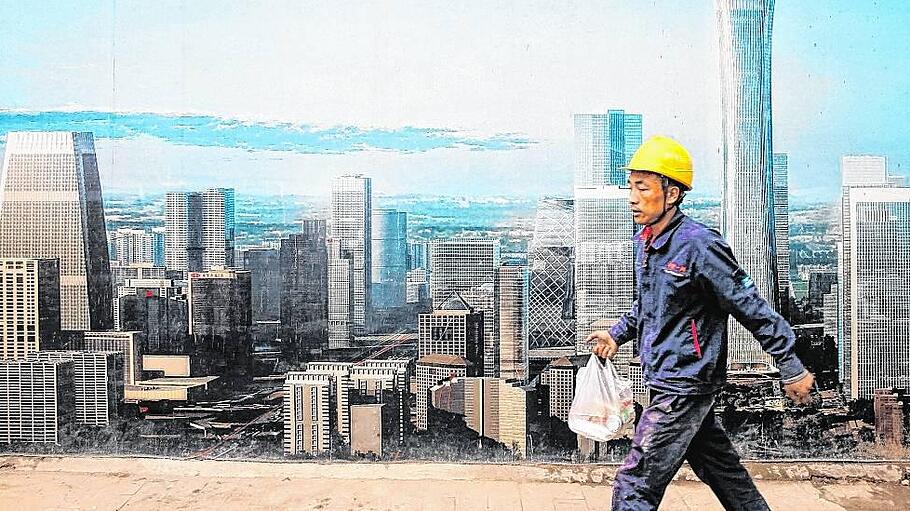Wenn Martin Rhonheimer (vgl. DT vom 25. Februar 2017, S. 14) auf die Vorzüge der Marktwirtschaft und die Probleme einer Zentralverwaltungswirtschaft oder des staatlichen Interventionismus hinweist, dann hat er Recht. Denn nur der Markt ist in der Lage, die vielfältigen Bedürfnisse der Menschen und die optimale Nutzung der zur Befriedigung dieser Bedürfnisse notwendigen Ressourcen zu koordinieren. Der Markt ist, wie es der große Ökonom und Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek (1899–1992), einmal in nüchterner Klarheit gesagt hat, ein „Mechanismus zur Vermittlung von Informationen“ – nicht mehr und nicht weniger.
Die Wunder des freien Marktes – ein libertärer Mythos
Martin Rhonheimer hält nicht nur die Soziale Marktwirtschaft, sondern auch die katholische Soziallehre für einen Mythos. Stattdessen erzählt er uns von einem Märchenland, in dem der Markt völlig frei ist und „Wohlstand für alle“ produziert. Was aber ist mit denen, die am Markt nicht aktiv werden können? Von Arnd Küppers