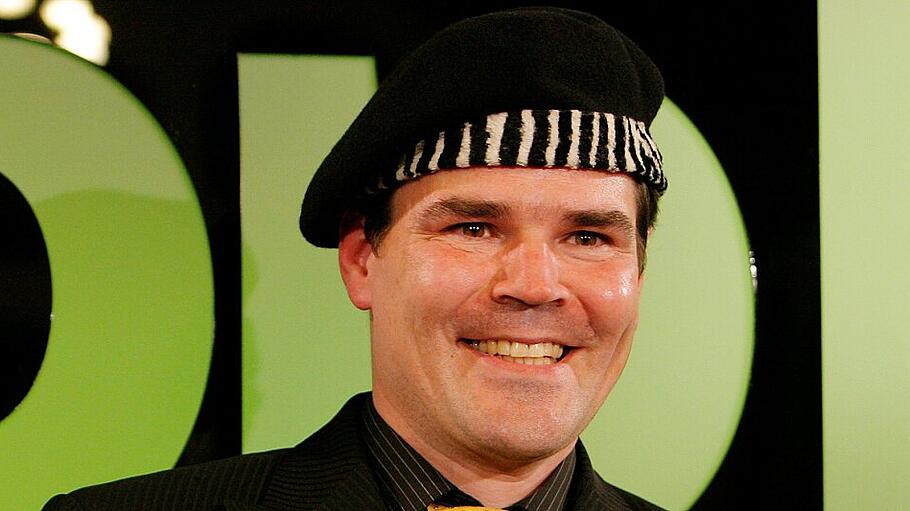Eine Geschichte zu erzählen, erinnert an die Suche nach dem wirklichen Blau. In der gleichnamigen Erzählung von Anna Seghers gerät der Töpfer Benito in Bedrängnis, weil er sein Geschirr nicht mehr mit dem beliebten und charakteristischen Blau herzustellen vermag, von dem es heißt: „Solch Blau gibt es nicht noch einmal“, denn der Krieg und das damit verbundene Handelsembargo schnitten den Töpfer von seinen Bezugsquellen in Deutschland ab. Wurde das, was gemeinhin deutsche Literatur genannt wird, von den Bezugsquellen der Geschichten, nämlich der Wirklichkeit getrennt? Hat sich die Belletristik in ihrer Gesamtheit womöglich als Teil des politisch-medial-kulturellen Komplexes in den modus irrealis begeben?
Die Rückkehr des Erzählers
Werden Romane noch der Wirklichkeit gerecht? Literaturkritik erschwert diesen Zugang.