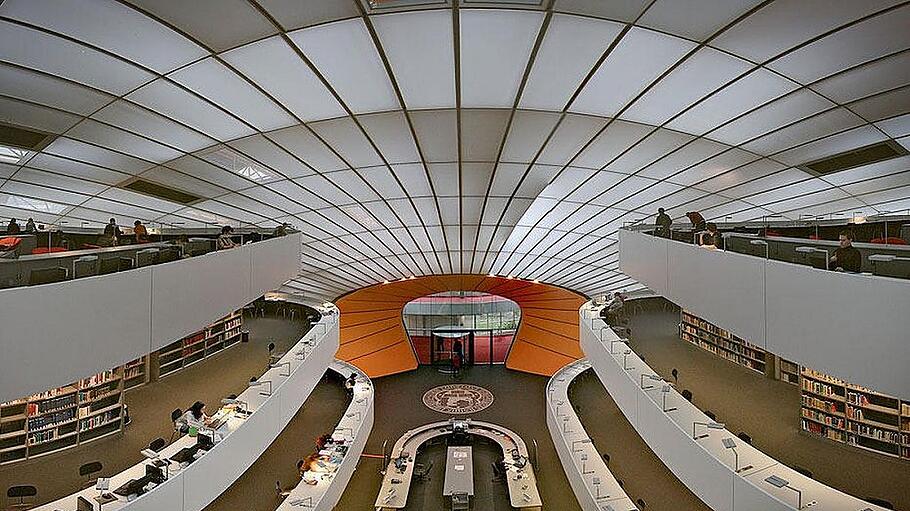In den nächsten Monaten wird sich die deutsche Hochschullandschaft verändern. Schon seit Jahren war nichts mehr von Eliteuniversitäten zu hören, doch seit dem 1. Januar gibt es einen neuen Anfang. Jetzt soll mit 533 Millionen Euro jährlich gefördert werden, zweimal sieben Jahre lang; 385 Millionen Euro für die Cluster und 148 Millionen für die Exzellenzuniversitäten. Doch wer das Geld bekommt, wird erst am 19. Juli entschieden.
Deutschland will Elite werden
Ein Förderprogramm stärkt die naturwissenschaftliche Spitzenforschung an Universitäten. Von Alexander Riebel