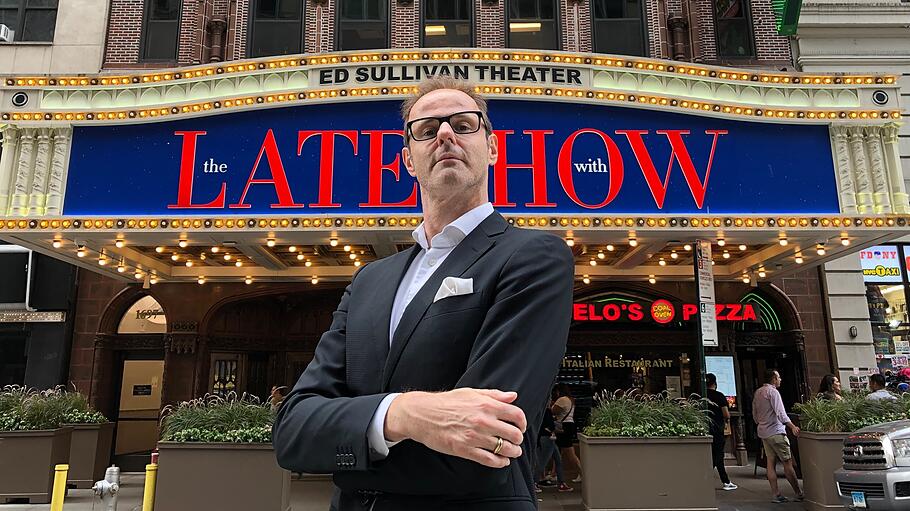„Soweit man es aus naturwissenschaftlicher Sicht beurteilen kann, hat unser Leben nicht den geringsten Sinn. Daher ist jeder Sinn, den wir unserem Leben geben, künstlich und somit reine Illusion.“ Diese Worte des Physikers und Kabarettisten Vince Ebert dürften als eine Art Konsens unserer Gesellschaft gelten. Oder vielleicht doch nicht? Schaut man in die Regale der Ratgeberliteratur, so scheinen Themen wie Selbstverwirklichung sehr wohl einen breiten Absatzmarkt zu finden. Sinnstiftung in der Wirtschaft Auch Unternehmen werben immer öfter mit einem sogenannten „corporate purpose“ um potentielle Mitarbeiter, also mit einem sinnstiftenden Mehrwert, den der Arbeitgeber jenseits der wirtschaftlichen ...
Es gibt den Sinn des Lebens
Wer die Selbstverwirklichung zum Ziel seines Lebens macht, landet bei der Sinnfindung in einer Sackgasse. Es ist dagegen der Gott des Evangeliums, der dem Willen eine Bestimmung gibt.