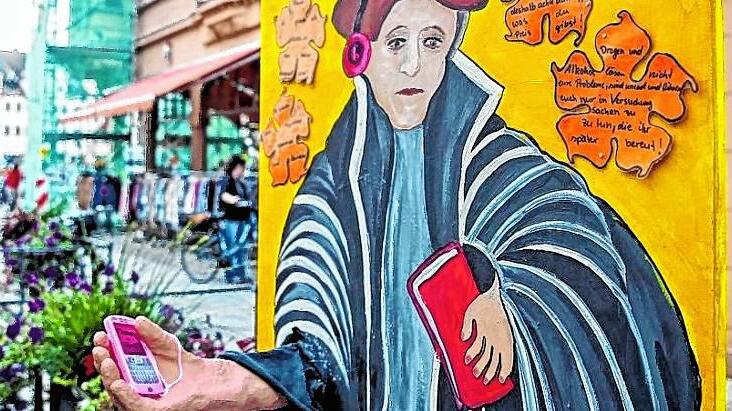Am Ende ist der verehrte Kardinal doch wohl eher ratlos. Das vor allem ist das Resultat, wenn sich der vergleichsweise weiche schwäbisch-katholische Ökumenismus an dem zerklüfteten Felsgestein namens Martin Luther bricht. Pünktlich zum Luther-Jubiläum hat der frühere Ökumene-Kardinal ein Büchlein zu Luther vorgelegt: „Martin Luther. Eine ökumenische Perspektive“, kleinformatig, knapp 94 Seiten, groß und mit weitem Zeilenabstand gedruckt und so vor allem für Alte und Ältere mit abnehmendem Sehvermögen gut und in einer Stunde lesbar. Die gewisse Ratlosigkeit bezieht sich vor allem auf die Grundfrage, warum überhaupt Kircheneinheit sein soll – geschweige denn, wie sie aussehen soll.
Wider die Überschätzung Luthers
Wie Kardinal Walter Kaspers Schrift über den deutschen Reformator und die Ökumene einzuordnen ist. Von Klaus Berger