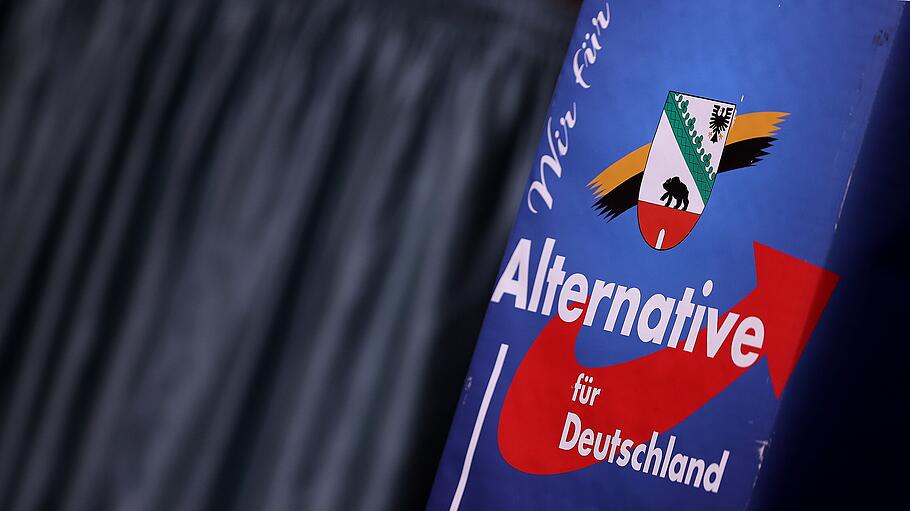Seit Jahren wird diskutiert, ob die 2013 gegründete Alternative für Deutschland als rechtsextremistischer Verdachtsfall zu gelten habe. Was richtig ist: Die Partei hat sich radikalisiert: Als politische Kraft gegen den Euro ins Leben gerufen, machte sie sich ab 2015 verstärkt den Kampf gegen die zum Teil unkontrollierte Zuwanderung zu eigen - sie ließ dabei aggressive populistische Anklänge erkennen. Heftige Zerwürfnisse, teils politisch, teils persönlich bedingt, suchten die Partei heim.
Umgang mit AfD: Der Rechtsstaat ist gefordert
Die AfD hat rechtsextreme Tendenzen, ist aber nicht rechtsextrem. Start einer Debatte.