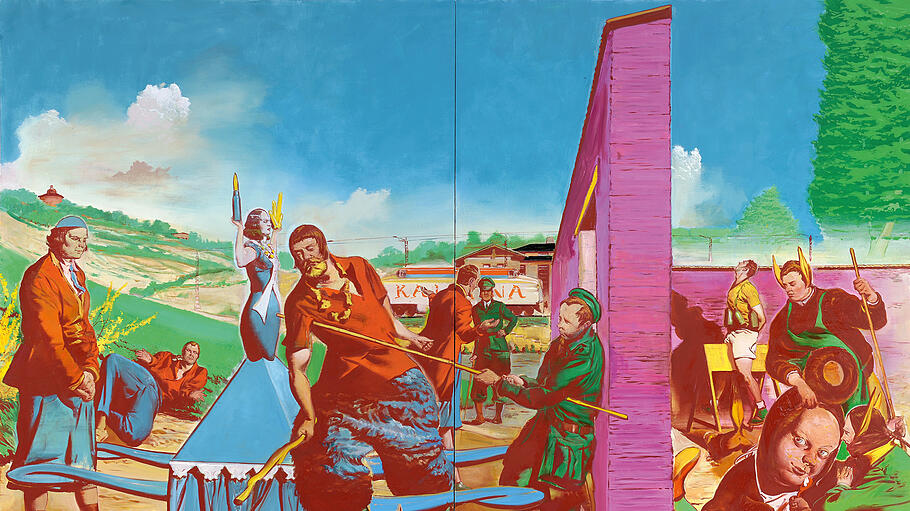Es war die kleine Erzählung „Der entwendete Brief“ von Edgar Allan Poe, die in den siebziger Jahren durch die literaturwissenschaftlichen Seminare deutscher Universitäten geisterte und Teil einer Revolution des Denkens wurde. Die kurze Geschichte wurde zum Kern postmoderner Dekonstruktion stilisiert; immerhin hatten ihr zentrale Vertreter der Postmoderne wie der Philosoph Jacques Derrida und der Psychoanalytiker Jacques Lacan viel beachtete Studien gewidmet. Poe erzählt von einem Brief mit kompromittierendem Inhalt, den ein Minister einer Königin entwendet und bei sich versteckt. Der Polizei gelingt es nicht, den Brief zu finden, ein Detektiv aber tauscht ihn gegen einen anderen aus.
Postmoderne unter Druck
Alles wird davon abhängen, ob es gelingt, postmoderne Beliebigkeit, die gesellschaftlich längst Fuß gefasst hat, zu irritieren.