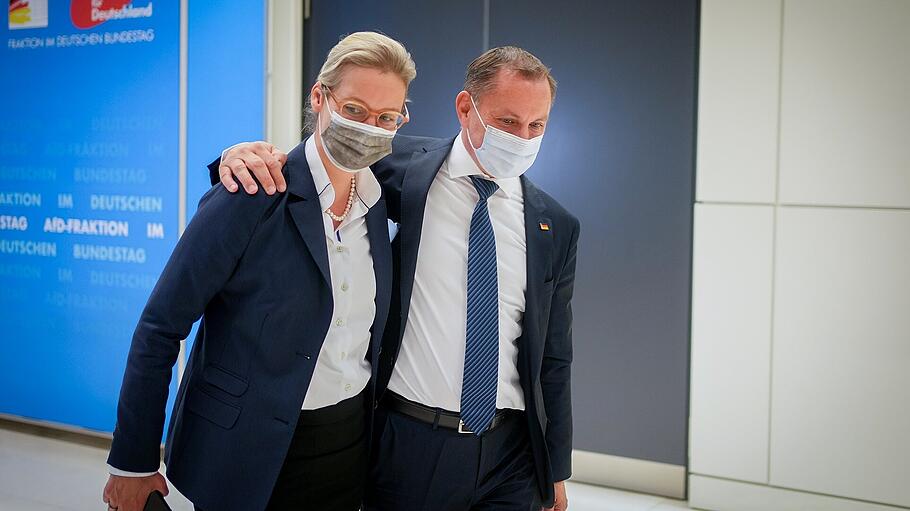Eine Woche nach der 20. Bundestagswahl, der neunten gesamtdeutschen, fand am 3. Oktober der Tag der Deutschen Einheit statt. 32 Jahre nach der „Freiheitsrevolution“ und 31 Jahre nach der „Einheitsrevolution“ ist das Wahlverhalten in den neuen und den alten Ländern höchst unterschiedlich. Das gilt selbst für das Ergebnis in der deutschen Hauptstadt (Ostberlin: SPD: 22,3; Grüne: 20,5; Die Linke: 16,1; CDU: 12,3; AfD: 10,8; FDP: 7,9 Westberlin: SPD: 24,3; Grüne: 23,7; CDU: 18,5; Prozent; FDP: 10,0; Die Linke: 8,1, AfD: 6.7 – jeweils in Prozent). Dabei ist innerhalb einer Stadt die Mobilität doch hoch, von Ost nach West, von West nach Ost.
Ostdeutschland wählt anders
Warum ist das noch so im 31. Jahr nach der Wiedervereinigung? Eine Analyse der Ursachen.