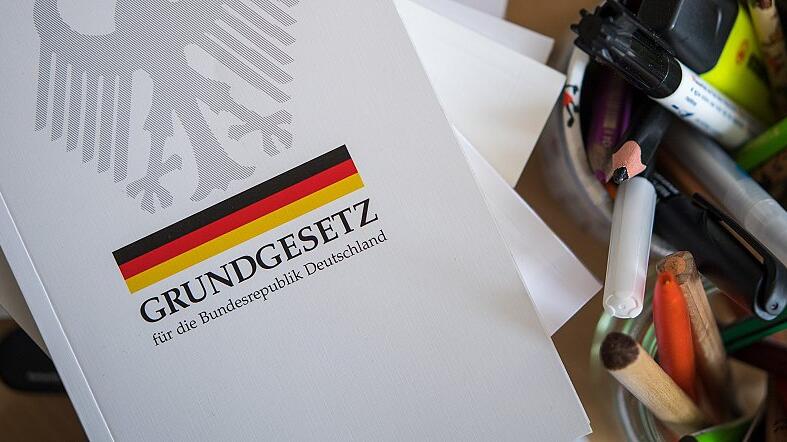Der Gottesbezug im Grundgesetz Auch wenn nicht mehr alle Menschen an Gott glauben, sollen alle Menschen die Gesetze akzeptieren, mehr noch: Sie sollen sie befolgen. Damit das funktioniert, muss eine Legitimation des Rechts gefunden werden, die nicht allein auf Bekenntnis und Weltanschauung fußt, doch gleichwohl die orientierende und motivierende Leistung des religiösen Glaubens für Normgenese und Gesetzestreue fruchtbar hält. Mit dem Gottesbezug in der Präambel des Grundgesetzes als „Ausdruck der Demut“ (so der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages 2016) gelingt diese Transferleistung der religiösen Vorstellung in den säkularen Rechtsdiskurs. Gleichwohl: Der Gottesbezug im Grundgesetz steht zunehmend in der ...
Gott und Grundgesetz
Wie kam Gott ins Grundgesetz?