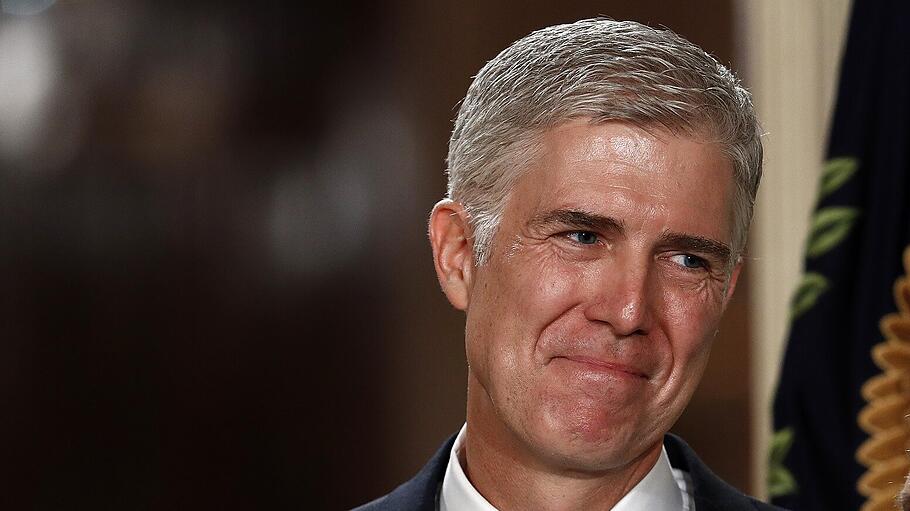Die Entscheidung Bostock v. Clayton County des US Supreme Court, mit der das im Civil Rights Act festgelegte Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts auf Fälle der Diskriminierung wegen der sogenannten „sexuellen Orientierung“ ausgedehnt wurde, ist aus europäischer Perspektive nicht so sehr wegen ihrer unmittelbar zu erwartenden praktischen Auswirkungen erstaunlich, wohl aber wegen der weiteren Implikationen, die sich für die sogenannten „LGBT-Rechte“ daraus ergeben.
Der Denkfehler der US-Richter
Die Entscheidung des US-Supreme Courts, das Verbot der Diskriminierung wegen des Geschlechts auf die Frage der sexuellen Orientierung zu übertragen, wird sich auch auf Europa auswirken. Eine Analyse.