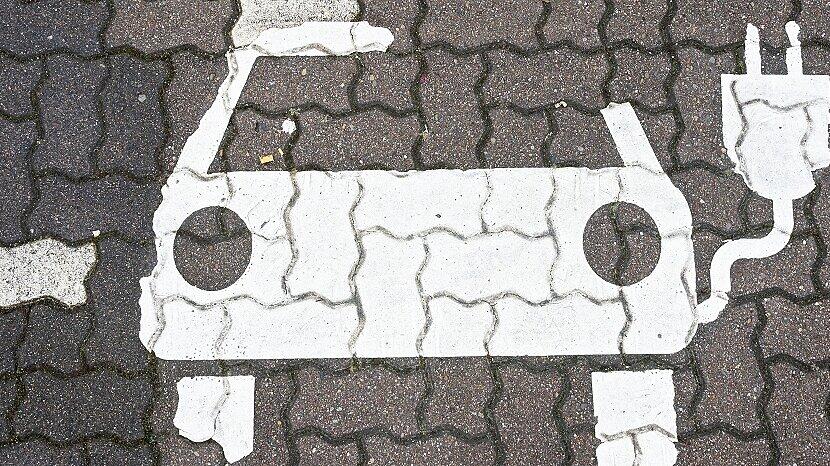Wenn es in den letzten Jahren um die Verkehrswende in Deutschland ging, dann hagelte es nicht selten Kritik. Diese Kritik, so konnte man meinen, hatte damals einen Namen: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Viele Kritiker atmeten deshalb auf, als sich unter der Führung der SPD ein Bündnis aus den Grünen und der FDP zu einer Ampelkoalition zusammenschloss. Dass das Verkehrsministerium an die Grünen gehen würde – das war für die meisten Beobachter während der Koalitionsgesprächen eine fest ausgemachte Sache. Es kam aber alles bekanntlich ganz anders: Der FDP-Politiker Volker Wissing führt nun das Verkehrsministerium und schon wird es laut seitens der Kritiker.
Keine Wende in Sicht
An den Menschen vorbei: Unter der Ampel-Koalition droht die Verkehrswende zu misslingen.