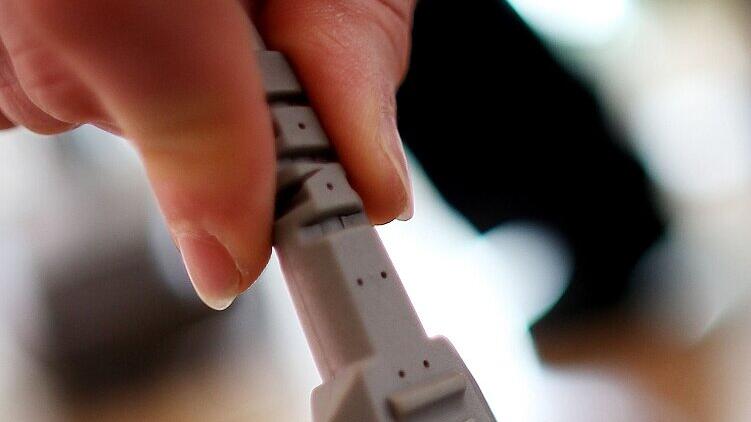Es versteht sich von selbst, dass der Stromverbrauch in allen Häusern und Wohnungen gezählt werden muss. Keineswegs selbstverständlich aber ist, dass die Kommunikation des Gezählten technologisch unbedingt per Mobilfunk erfolgen muss. Und das sagt auch kein Gesetz ausdrücklich. Gleichwohl tendiert die derzeitige Entwicklung in diese Richtung. Denn alles zielt beim Stromzählen auf sogenannte Smart Meter Gateways. Der Einbau dieser sehr häufig funkenden „intelligenten Messsyteme“ soll in den nächsten Jahren Stück um Stück vorangetrieben werden. So will es das am 11. Januar dieses Jahres vom Bundeskabinett beschlossene und im Parlament inzwischen zur 2. Lesung anstehende Gesetz zum „Neustart der Digitalisierung der ...
Ethik des Stromzählens
Der Bundestag berät ein neues Gesetz, wie der Stromverbrauch der einzelnen Haushalte künftig erfasst werden soll. Gehen die Pläne zu Lasten des Datenschutzes und der Gesundheit?