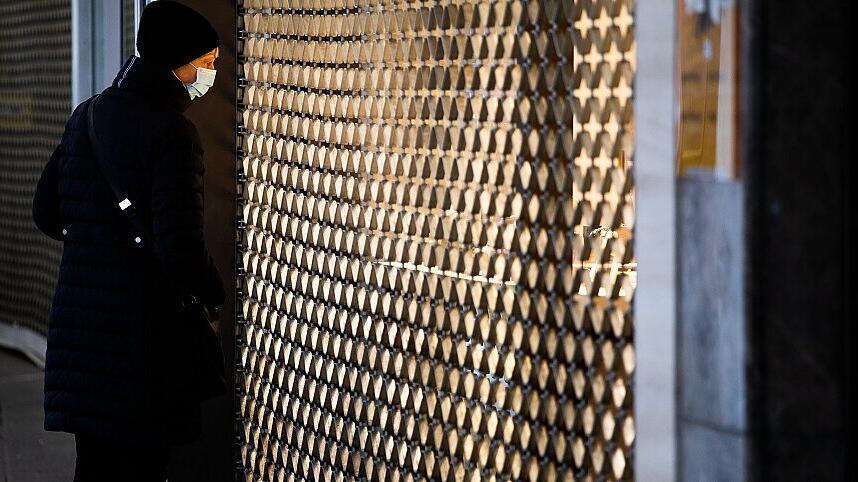Die Debatte um eine Vermögensabgabe ist in der Corona-Krise neu entflammt. Dabei wird häufig das Lastenausgleichsgesetz zum Vorbild für eine Corona-Abgabe stilisiert. Sie soll starke Schultern verpflichten, mehr Lasten zu tragen, um wirtschaftliche und soziale Folgen der Corona-Pandemie auszugleichen. In der Debatte wird darauf verwiesen, dass auch das Lastenausgleichsgesetz abgeleitet wurde aus der sozialen Idee Ludwig Erhards von der Marktwirtschaft. Dennoch bin ich skeptisch, ob ein Lastenausgleichsgesetz 2.0 in der aktuellen Situation ein sinnvolles Instrument wäre.
Corona-Abgabe für Superreiche?
Wer soll zur Lösung der Finanzprobleme, die durch die Panbdemie entstanden sind beitragen? Es geht um soziale Gerechtigkeit, aber nicht im Sinne eines neuen Lastenausgleichs. Zweiter Teil der Debatte.