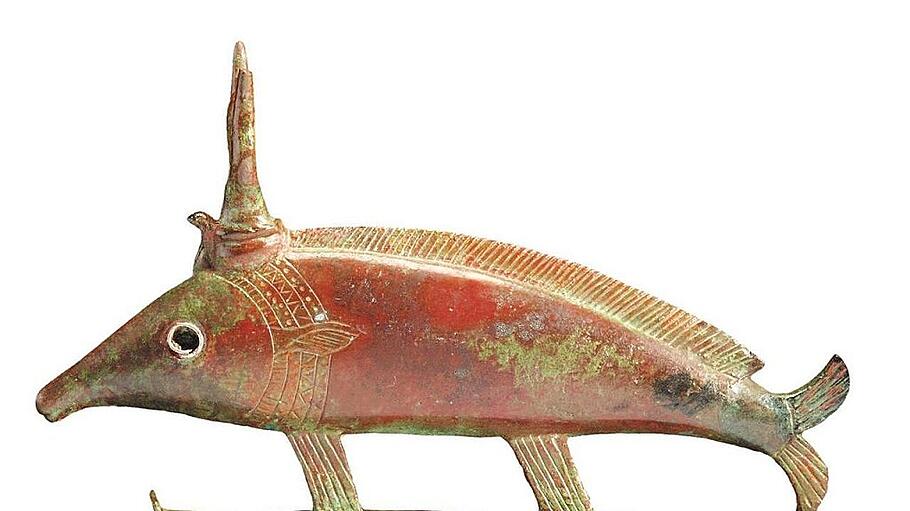Kann die Bibel irren? Existieren womöglich jenseits von Gottes geoffenbartem Wort beweisbare naturwissenschaftliche Wahrheiten, die der Heiligen Schrift widersprechen? Das Christentum, ein bloßer Mythos? Diese Fragen trieben das 19. Jahrhundert in zunehmendem Maße um. Nicht erst Darwins „Entstehung der Arten“ raubte dem Menschen den Platz als Krone der Schöpfung und hängte ihn deutlich tiefer in die schnöde Reihe der trockennasigen Altweltprimaten. Spätestens seit Napoleons Ägyptenabenteuer nagte immer öfter der Zweifel an der Verlässlichkeit etwa der mosaischen Geschichte von der Schöpfung, deren Datum der fromme irische Bischof Ussher durch Addition der biblischen Ahnenreihen und Patriarchenviten auf den Vorabend des 23.
Kann die Bibel irren?
Die Oxyrhynchus-Papyri bleiben der bis heute umfangreichste Fund an frühchristlichen Manuskripten.