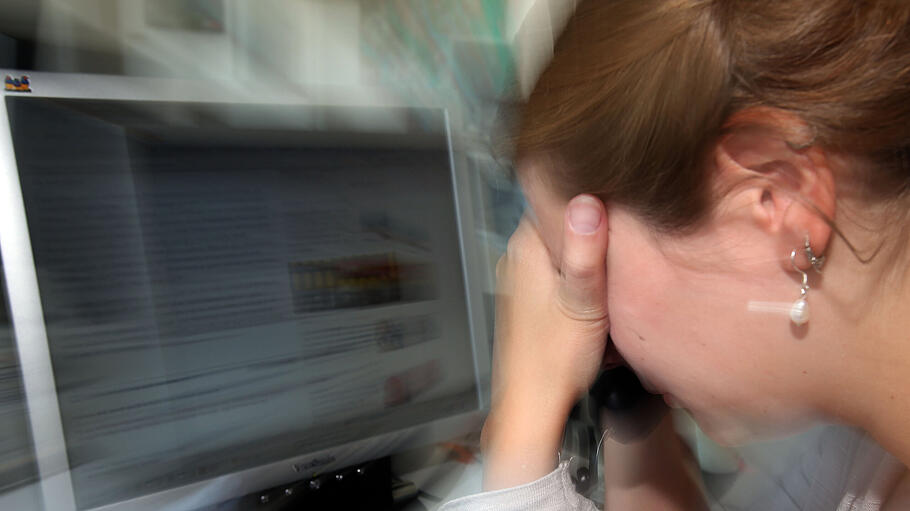Die Corona-Pandemie hat zu einem signifikanten Anstieg psychischer Leiden geführt. Das lässt sich nun wissenschaftlich belegen. Eine Studie der Donau-Universität Krems und des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie (ÖBVP) belegt, dass bereits nach zwei Wochen Ausnahmezustand 70 Prozent der Psychotherapie-Patienten ausschließlich über negative Auswirkungen der Maßnahmen gegen COVID-19 berichteten: Von Angst, Einsamkeit und Isolation war da die Rede. 16,3 Prozent berichteten über negative und positive Auswirkungen der Maßnahmen, nur 8,5 Prozent sahen keine Auswirkungen. Die psychischen Symptome wurden nicht nur stärker, es kehrten auch überwunden geglaubte Traumata zurück.
Psyche im Ausnahmezustand
Ängste, Depressionen, Schlafstörungen, Einsamkeit – Wer bisher Psychotherapie benötigte, leidet in der Corona-Pandemie gleich mehrfach.