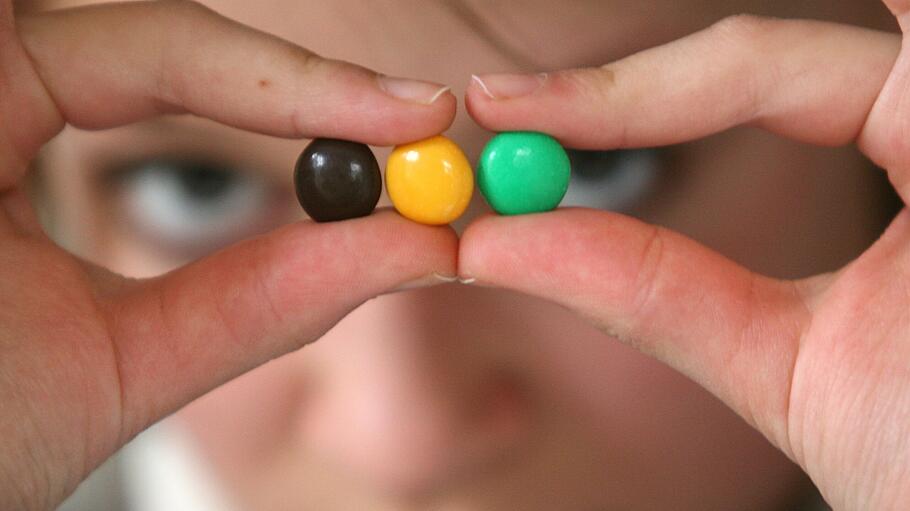Sie wollen abnehmen? Warum nicht mit Schokolade. Deren Wirksamkeit für die Zwecke der Gewichtsreduktion ist endlich durch wissenschaftliche Studien erwiesen. So lauteten kürzlich Schlagzeilen mehrerer populärer Medien, die sich auf Ergebnisse des "Institute for Health and Diet" in Mainz um den deutschen Molekularbiologen Dr. John Bohannon stützen. Erst nach einiger Zeit und umfangreichen Recherchen wurde die Studie als Farce entlarvt. Denn was im wissenschaftlich-seriösen Mäntelchen daherkam, war in Wirklichkeit ein Versuch der Forschergruppe, auf die erschreckende Häufigkeit falsch positiver Forschungsergebnisse und deren unkritische Rezeption in Populärmedien aufmerksam zu machen. Mit vollem Erfolg.
Kann man der Wissenschaft noch trauen?
Falsch positive Forschungsergebnisse stellen die Psychologie zunehmend infrage – mit bedenklichen Implikationen.