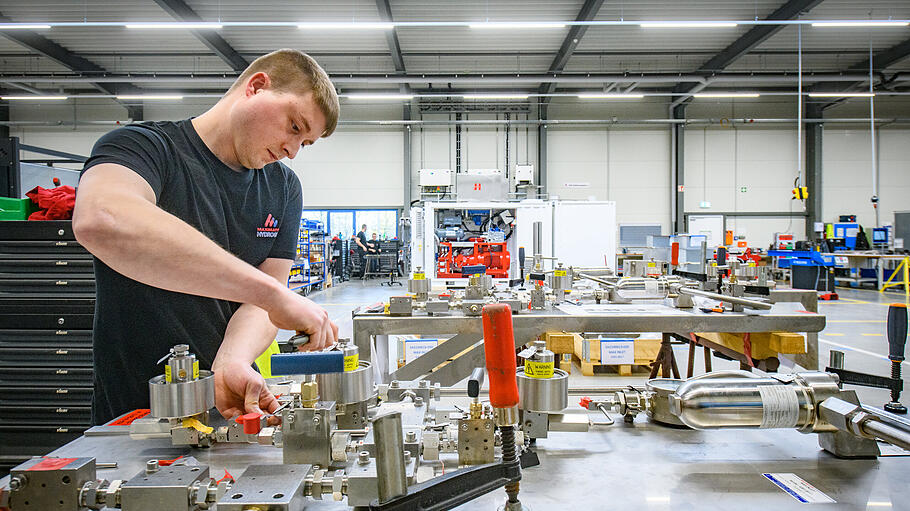Die Technik, die wir schufen, um freier zu werden, schränkt uns zunehmend ein. Zumindest besteht diese Gefahr. Vor dem Hintergrund der düsteren Prognosen zum Klimawandel will auch die Technik – beziehungsweise deren Entstehung, Entwicklung und Nutzung – gerechtfertigt sein. In seinem Aufsatz „Malum technologicum. Die Technodizee als Transformation der Theodizee“ entwickelt der Philosoph Hans Poser den Gedanken, das Grundübel unserer Zeit bestehe in der Möglichkeit einer Einschränkung menschlicher Freiheit durch die negativen Folgen der Technik.
Hans Poser: Gute Technik, böse Technik
Wissenschaft, Technik und Moral zusammenzubringen, ist Anliegen der Technodizee, eines Ansatzes, den der vor einem Jahr verstorbene Berliner Philosoph Hans Poser in Analogie zur Theodizee entwickelt hat.