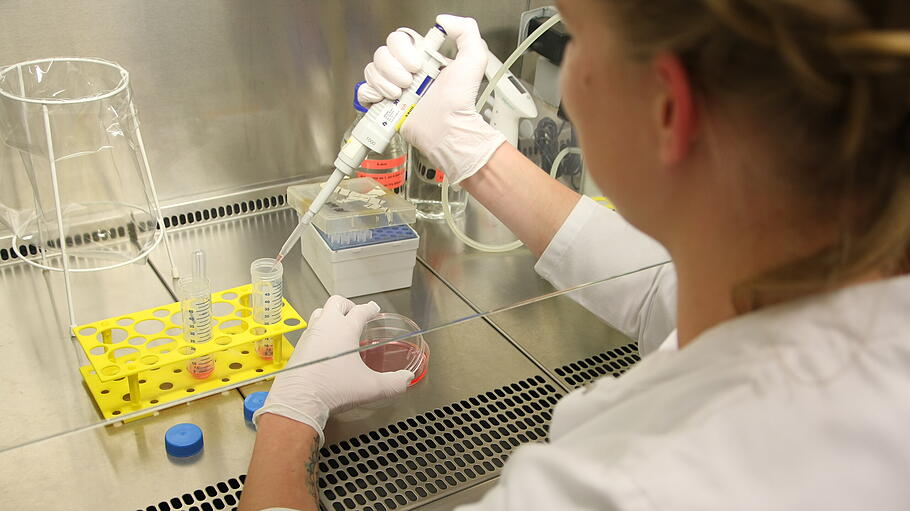Im vergangenen Jahr überraschte der chinesische Biophysiker He Jiankui die Welt und die Wissenschaft, als er am 25. November die Geburt von zwei Zwillingsmädchen bekannt gab, deren Erbgut er zuvor im Alleingang mit der CRISPR/Cas-Technologie genetisch verändert hatte. So schien es jedenfalls, nachdem sich die Gemeinschaft der Wissenschaftler, die „scientific community“, auf dem 2. Internationalen Gipfeltreffen der CRISPR/Cas-Forscher Anfang Dezember in Hongkong völlig schockiert über die Experimente des Chinesen gezeigt hatte.
Die Mitwisser
Bislang galt die Geburt der beiden ersten genetisch veränderten Kinder als eine in aller Heimlichkeit durchgeführte Tat eines außer Kontrolle geratenen Wissenschaftlers. Nun muss diese Geschichte offenbar entscheidend korrigiert werden.