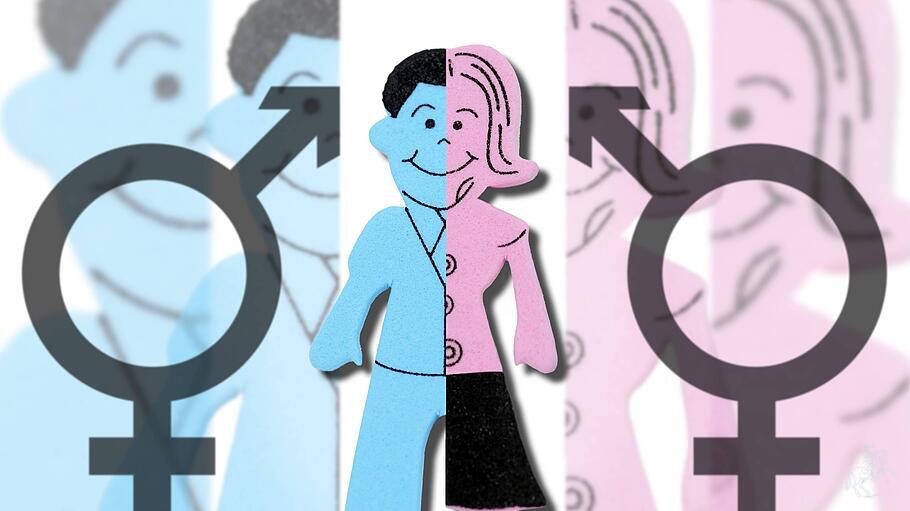Das „Rahmenkonzept für Sexuelle Bildung“ an den katholischen Schulen im Erzbistum Hamburg ist ein ambitionierter Versuch, eine moderne, akzeptanzorientierte Sexualpädagogik im kirchlichen Schulraum zu etablieren. Es versteht sich – programmatisch – nicht als theologisches, sondern als pädagogisches Konzept; und klingt zunächst auch danach. Vor allem, wenn es von der Unterstützung des jungen Menschen in seiner Identitätsfindung und Persönlichkeitsentwicklung spricht (S. 33). Gleichwohl sucht man vergeblich, wie diese Unterstützung realisiert werden soll.
Sexuelle Bildung: Affirmation statt Auseinandersetzung?
Im Hamburger Rahmenkonzept für katholische Schulen wird die jugendliche Fluidität im Bereich sexueller Orientierung ausgeblendet. Eine kritische Betrachtung.